Den Krieg beenden durch den Aufbau des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße
Teil 4b: Regionale und kontinentale Verkehrskorridore
Von Hussein Askary und Dean Andromidas
Mit den in der letzten Ausgabe (Neue Solidarität 50/2014)
beschriebenen neuen positiven Entwicklungen kann die Situation auf Dauer
verändert werden. Es gibt eine ganze Reihe wichtiger Pläne für
Entwicklungskorridore im Nilbecken, von denen einige schon verwirklicht
werden, andere fertig vorliegen und wieder andere noch studiert werden. Einige
davon sind nationale Pläne, wie der ägyptische Entwicklungskorridor, den wir
in Teil 2 dieser Serie vorgestellt haben, andere haben einen regionalen oder
sogar kontinentalen Charakter und werden in diesem Teil beschrieben.
Die wichtigste Vision der Afrikanischen Union (AU) ist es, durch die
Transafrikanischen Autobahnen (Trans-African Highways, TAH) den Kontinent in
Nord-Süd- und Ost-West-Richtung zu vernetzen. Das TAH-Konzept wurde in den
1970er Jahren entwickelt. Es ist eine Kombination von neun großen
Verkehrskorridoren in Afrika, welche mehreren Zwecken dienen sollen:
Bild: AU
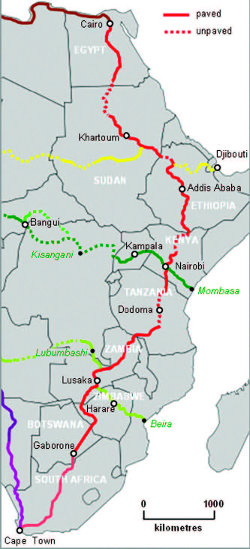
Abb. 1: Die Transafrikanische Autobahn Kairo-Kapstadt
Karte: Dr. Farouk El-Baz
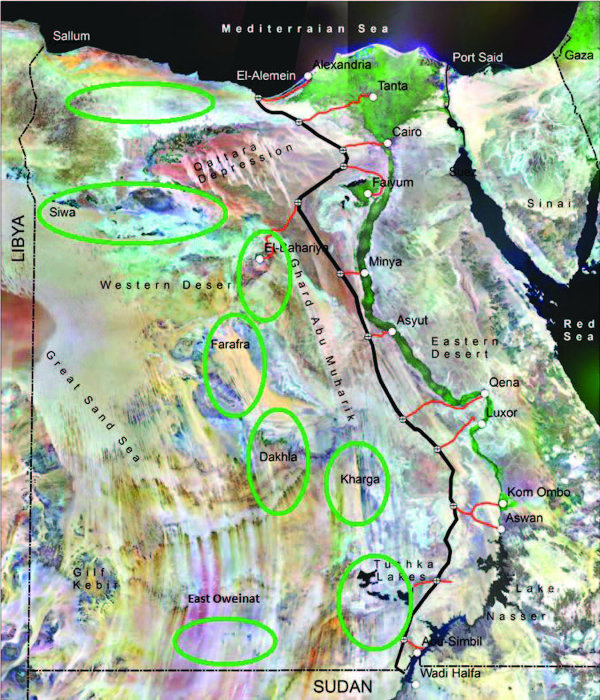
Abb. 2: Das von dem ägyptischen Wissenschaftler und Präsidentenberater Dr.
Farouk El-Baz vorgeschlagene Projekt „Neues Tal“
a) möglichst direkte Verkehrsverbindungen zwischen den wichtigsten Städten
des Kontinents schaffen,
b) politisch, wirtschaftlich und sozial die Integration und den
Zusammenhalt Afrikas fördern,
c) Straßenverbindungen zwischen wichtigen Regionen der Produktion und des
Verbrauchs auf dem Kontinent verfügbar zu machen.
Vier dieser neun Korridore verlaufen durch die Nilregion: die Verbindungen
Kairo-Kapstadt, Lagos-Mombasa, Dakar-N’Djamena-Dschibuti und Kairo-Dakar.
Diese Strecken sind wichtig für die Verbindungen zwischen den Anliegerstaaten
des Nil. Allerdings sind Straßen, wie schon (in Teil 4a) gesagt, kein
effizientes Mittel für den Transport über mittlere und längere Distanzen, dazu
müssen sie durch Eisenbahnen ersetzt oder ergänzt werden.
Wir geben im folgenden einen Überblick über die schon gebauten oder
geplanten Korridore in dieser Region.
1. Ägyptens Nord-Süd-Entwicklungskorridor
Der ägyptisch-amerikanische Weltraumwissenschaftler Dr. Farouk El-Baz, der
Ägyptens Präsident Abdul Fattah Al-Sisi als Wissenschafts- und
Wirtschaftsberater dient, hat einen Entwicklungskorridor vorgeschlagen, den
man als Startrampe für den Korridor Kairo-Kapstadt (Abbildung 1)
betrachten kann.
Die Ägypter sprechen bescheiden von einem „nationalen“
Entwicklungsprojekt - der Entlastung des dichtbevölkerten Niltals durch ein
mehrschichtiges Verkehrsnetz parallel dazu in der Westlichen Wüste -, aber das
Projekt hat regionale und kontinentale Bedeutung. Das „Neue Tal“ (Abbildung
2) sieht folgendes vor:
a) eine 1200 km lange Autobahn nach modernstem internationalen Maßstab vom
Westen Alexandrias bis zur Südgrenze Ägyptens;
b) davon abzweigend zwölf Ost-West-Strecken mit einer Gesamtlänge von etwa
800 km, um die Autobahn mit den Bevölkerungszentren am Nil zu verbinden;
c) eine Eisenbahn für den schnellen Transport, parallel zur Autobahn;
d) eine vom Toschka-Kanal abzweigende Wasserpipeline, um die
Trinkwasserversorgung entlang des Korridors sicherzustellen;
e) eine Hochspannungsleitung für die Stromversorgung.
Dieser ägyptische Korridor läßt sich leicht nach Süden in den
Sudan und bis zu den ostafrikanischen Großen Seen verlängern.
Wie in anderen afrikanischen Ländern herrscht auch im
Güterverkehr zwischen Ägypten und dem Sudan der Straßenverkehr vor. Aber bis
vor kurzem haben die politischen Differenzen zwischen den Regierungen der
beiden Länder sogar dieses sehr teure Verkehrsmittel behindert. Erst im August
dieses Jahres (2014) wurde der Grenzübergang Qastal fertiggestellt, über den
Assuan in Ägypten durch eine moderne Schnellstraße mit Wadi Halfa im Sudan
verbunden wird. Die Straße kreuzt den Toschka-Kanal, der ein Teil des
projektierten „Neuen Tals“ ist, und führt weiter bis Wadi Halfa. Sie verläuft
parallel zu der 550 km langen Fährverbindung zwischen Assuan und Wadi Halfa
über den durch den Assuandamm aufgestauten Nassersee (siehe Abschnitt über die
Binnenschiffahrt weiter unten). Nach ägyptischen Schätzungen kann der Handel
zwischen den beiden Ländern dank der Straße von 850 Mio. $ auf 2 oder sogar 3
Mrd.$ gesteigert werden.
Die Kosten des Transports von einer Tonne Gütern mit dem
Flugzeug sind sechsmal so hoch wie über die Straße. Aber der Bau von
Eisenbahnen würde die Kosten noch weiter senken und die Entwicklung dieser
abgelegenen und unterbevölkerten Regionen der beiden Länder beschleunigen. Das
ägyptische Eisenbahnnetz endet bisher in Assuan, das des Sudan in Wadi Halfa.
Die Eisenbahn nach Wadi Halfa ist eine Schmalspurbahn, die ursprünglich für
die britische Invasion des Sudan 1897 gebaut wurde. Sie muß dringend
modernisiert und auf die Standardspurweite umgestellt werden, um sie mit dem
ägyptischen Streckennetz kompatibel zu machen. Sie verläuft über 600 km nach
Atbara, wo eine 350 km lange Zweigstrecke nach Port Sudan am Roten Meer führt,
und über weitere 330 km bis Khartum nach Süden. Sie bildet das Rückgrat des
sudanesischen Eisenbahnnetzes. Die Strecke führt an mehreren Staudämmen und
Landwirtschaftsprojekten vorbei - entweder schon fertiggestellt wie der
Merowe-Damm, im Bau wie der Atbara-Damm, oder in Planung wie der Kajbar-Damm
nahe der Grenze zu Ägypten. Das macht die Route zu einem unverzichtbaren Teil
des Entwicklungskorridors, der die Wirtschaft des Landes und der Region auf
eine neue Stufe heben wird.
Die Eisenbahnen südlich von Khartum sind in ähnlichem Zustand
wie die Wadi-Halfa-Bahn. Die Hauptstrecke von Khartum nach Babanusa und Nyala
im Süden und Südwesten, wo das Streckennetz des Sudan endet, ist schlecht
erhalten und muß grundlegend erneuert werden. Die einzige Bahnverbindung in
den Südsudan führt von Babanusa nach Wau. Der Ausbau der Verkehrsverbindungen
in den Südsudan und die übrigen Nationen des Nilbeckens ist stark abhängig von
den politischen Beziehungen zwischen beiden Seiten, von der inneren Lage
zwischen den sich bekämpfenden Gruppen im Südsudan und ganz besonders von den
neuen wirtschaftlichen und politischen Beziehungen, die durch die chinesische
Investition in den Lamu-Korridor (s.u.) entstehen werden.
2. Der Sudan-Dakar-Korridor
Vor der Abspaltung des Südsudan von der Republik Sudan 2011 war der Sudan
maßgeblich an den Bemühungen beteiligt, den Plan der Verbindung der ost- und
westafrikanischen Nationen durch ein modernes Eisenbahnnetz wiederzubeleben.
Das Projekt wurde vom Sudan 2005 beim Gipfeltreffen der Organisation für
islamische Zusammenarbeit (OIC) vorgelegt und im Mai 2008 beim OIC-Gipfel in
Dakar (Senegal) einstimmig beschlossen. Im Dezember 2009 gab es in Khartum
eine Konferenz der Verkehrsminister der OIC-Mitgliedstaaten über den Bau der
Dakar-Port Sudan-Bahn, wie sie inzwischen offiziell heißt. Aber fehlende
finanzielle Mittel und die instabile politische Lage im Sudan haben die
Umsetzung des Projekts bisher verhindert.
Karte: EIR
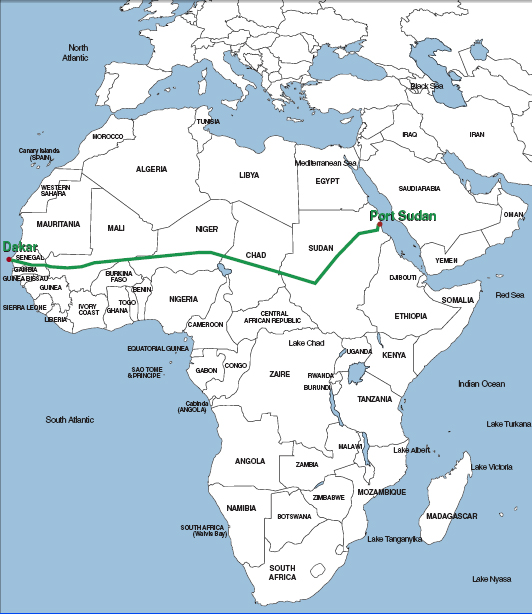
Abb. 3: Die geplante Bahnverbindung von Dakar im Senegal im Westen Afrikas
nach Port Sudan am Roten Meer
Die Dakar-Port Sudan-Bahn (Abbildung 3) ist ein transkontinentales
strategisches Verkehrs- und Infrastrukturnetz. Die Ost-West-Hauptstrecke
verbindet den Sudan, Tschad, Niger, Mali und Senegal. Durch Abzweigungen
sollen Dschibuti, Libyen, Uganda, Kamerun, Nigeria, Burkina Faso und Guinea
mit dieser Hauptstrecke verbunden werden. Wenn die Strecken Kairo-Khartum und
Dakar-Rabat fertiggestellt sind, besteht eine direkte Landverbindung zwischen
dem Mittelmeer, dem Roten Meer, dem Atlantik und dem Indischen Ozean. Es wird
eine integrierte wirtschaftlich-strategische Einheit für die Entwicklung des
Kontinents gebildet.
Dieses Eisenbahnnetz wird sich über 14.000 km erstrecken und sich mit
wichtigen Wasser- und Landwirtschaftsprojekten überschneiden, für die sich
Lyndon LaRouche und seine Bewegung schon seit Jahrzehnten einsetzen - wie etwa
das Transaqua-Projekt zur Leitung von Wasser aus dem Kongo über ein modernes
Kanalnetz zum Tschadsee. Das Projekt ist auch ein wichtiger Schritt zur
Stabilisierung der Region Darfur im westlichen Sudan, die unter dem
Bürgerkrieg bzw. Stellvertreterkrieg mit den vom Westen und vom Tschad
unterstützten sudanesischen Rebellen enorm gelitten hat. Mit der
Normalisierung der Beziehungen zwischen dem Tschad und dem Sudan und dem
voranschreitenden Friedensprozeß mit den sudanesischen Rebellen in Darfur kann
auch diese Region in den Genuß der Vorteile dieses Entwicklungskorridors
gelangen.
Aber dazu müssen die Eisenbahnen des Sudan gründlich modernisiert und das
bestehende, kaum funktionsfähige Schmalspursystem auf die internationale
Standardspurweite umgestellt werden. Die Priorität muß dabei sein, die Strecke
Khartum-Port Sudan zu erneuern und weiter nach Babanusa und zur Hauptstadt der
Provinz Süddarfur - Nyala nahe der Grenze zum Tschad - auszubauen. Es laufen
schon in verschiedenen Teilen des Sudan mit chinesischer Unterstützung
Arbeiten zur Modernisierung des 5000 km langen Eisenbahnnetzes des Sudan,
einem der größten in Afrika. Aber bisher ist nicht geplant, es von der
Schmalspur auf die Standardspur umzustellen. Angesichts des enormen
internationalen politischen und wirtschaftlichen Drucks, der seit 30 Jahren
auf den Sudan ausgeübt wird, kann der Sudan diese gigantische Aufgabe nicht
mit eigenen Mitteln erfüllen, internationale Unterstützung ist unbedingt
notwendig.
Im März 2011 unterzeichnete der Tschad einen 7-Mrd.-$-Vertrag mit dem
chinesischen Konzern China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC),
um eine 1340 km lange Bahnstrecke zu bauen, die den Tschad mit Kamerun und dem
Sudan verbinden soll. Der Tschad begann 2003, mit Hilfe der US-Konzerne
ExxonMobil und Chevron und des malaysischen Ölkonzerns Petronas Rohöl zu
fördern. Eine 1070 km lange Pipeline wurde gebaut, um Öl durch Kamerun auf den
Weltmarkt zu exportieren. 2011 betrug die Rohölförderung 115.000 Faß täglich,
2012 etwa 105.000 Faß, wovon der größte Teil exportiert wird, um dem verarmten
Land dringend benötigte Einnahmen zu verschaffen.
Die China National Petroleum Corp. (CNPC) und die Regierung des Tschad
bauten gemeinsam die Raffinerie in N’Djamena mit einer Kapazität von 20.000
Faß Öl täglich, die 2011 den Betrieb aufnahm und den lokalen Markt mit
Erdölprodukten versorgt.
Diese zusätzlichen Einnahmen halfen dem Tschad, 2009 ein Programm zum Bau
von Infrastrukturprojekten einzuleiten. Aber das nationale Eisenbahnprogramm
mit den Verbindungen nach Kamerun und in den Sudan wird von China finanziert.
Der 5,6-Mrd.$-Plan sieht den Bau eines 1364 km langen Streckennetzes nach
chinesischen Standards vor, auf dem Dieselzüge mit Tempo 120 km/h fahren
sollen. China liefert auch die Lokomotiven und Waggons, die Arbeiten sollen
vier Jahre dauern.
Es sind zwei Strecken vorgesehen. Die östliche Linie wird 836 km lang sein
und von N’Djamena nach Adré an der Grenze zum Sudan führen. Im vergangenen
Jahr unterzeichneten China und der Sudan eine Vereinbarung über den Bau einer
rund 300 km langen Strecke über die Marra-Ebene im Westen Darfurs, um die
bisherige Endstelle Nyala mit dem Tschad zu verbinden. Die Südstrecke wird
über 528 km von der Hauptstadt N’Djamena nach Moundou an der Grenze zu Kamerun
führen. In Kamerun müssen dann weitere 250 km gebaut werden, um in Ngaoundéré
die Verbindung zum Eisenbahnnetz Kameruns herzustellen. Dem Vernehmen nach hat
Kamerun inzwischen einen nationalen Eisenbahn-Entwicklungsplan ausgearbeitet,
um ein modernes Bahnnetz mit Standardspurweite zu schaffen. Das Programm wurde
in Zusammenarbeit mit den südkoreanischen Unternehmen Korpec und Chunsuk
Engineering ausgearbeitet, nun sollen Machbarkeitsstudien durchgeführt werden.
Ein wesentliches Element des Programms sind Verbindungen zu den Nachbarländern
Nigeria, Tschad und Kongo.
3. Der Lamu-Korridor
Der Lamu-Korridor - seine offizielle Bezeichnung ist Transportkorridor
Lamu-Südsudan-Äthiopien (LAPSSET) - ist ein regionales
Verkehrsinfrastrukturprojekt, das die landeingeschlossenen Staaten Südsudan
und Äthiopien in das ostafrikanische Verkehrsnetz einbindet. Das Projekt
umfaßt eine ganze Reihe von Komponenten, darunter:
Karte: Wikimedia Commons
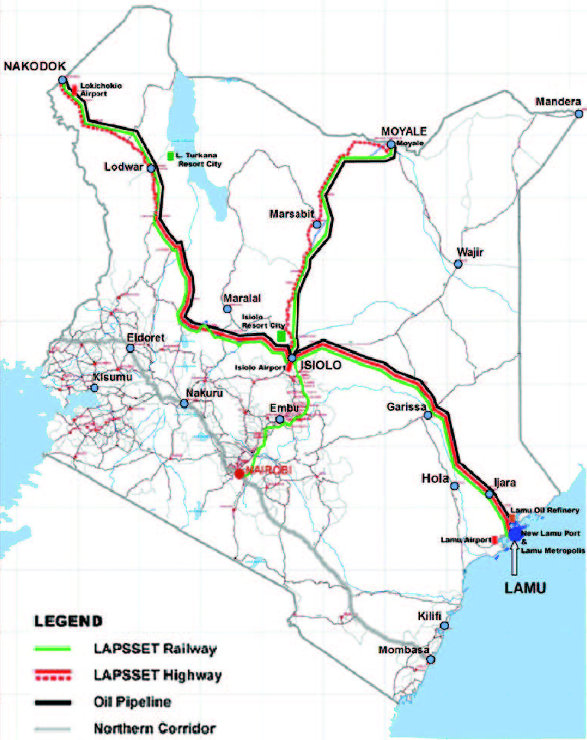
Abb. 4: Der Verkehrskorridor Lamu-Südsudan-Äthiopien (LAPSSET)
- ein Tiefseehafen mit 32 Liegeplätzen in Manda Bay bei Lamu in
Kenia;
- eine Eisenbahn mit Standardspurweite von Lamu nach Juba im Südsudan
mit einer Abzweigung von Isiolo über Moyale nach Addis Abeba;
- zweispurige Autobahnen von Lamu über Isiolo nach Juba und von Isolo
über Moyale nach Addis Abeba;
- Ölpipelines vom Südsudan nach Lamu und von Äthiopien nach Lamu, die
dem Südsudan eine Alternative zum Export von Rohöl durch den Sudan zum Hafen
Port Sudan am Roten Meer eröffnen;
- eine Ölraffinerie in Lamu;
- Glasfaserkabel;
- drei Flughäfen (in Lamu, Isiolo und Turkana) sowie
- drei Ferienzentren (in Lamu, Isiolo und Turkana).
Der Lamu-Korridor (Abbildung 4) gehört zu den größten
Infrastrukturprojekten in Afrika, die Kosten werden auf 24,5 Mrd.$ geschätzt,
was hauptsächlich die Regierungen von Kenia, Äthiopien und Südsudan
finanzieren werden. Ein Teil des Projekts soll durch internationale Kredite
finanziert werden, doch angesichts der ablehnenden Haltung des Westens
gegenüber solchen Entwicklungsprojekten werden die Gelder vermutlich aus China
und den BRICS-Staaten kommen. Das Projekt soll 2018 fertiggestellt werden.
Im neuen Hafen von Lamu werden extrem große („Capesize“) Frachtschiffe
ankern können. Er wird den überfüllten Hafen Mombasa entlasten und den
Warenstrom im Im- und Export erleichtern.
Am 2. August unterzeichneten die Kenia Ports Authority und die China
Communications Construction Co. (CCCC) einen Vertrag über den Bau des neuen
Hafens Lamu. Am Vortag waren die Regierungschefs von Kenia, Uganda, Südsudan
und Äthiopien in Nairobi zusammengekommen, um über die Finanzierung des
Lamu-Korridors zu sprechen. Die Bauarbeiten haben im September begonnen.
4. Die Nord-Süd-Wirtschaftsachse
Neben Straßen und Eisenbahnen bildet der Transport durch See- und
Binnenschiffahrt das dritte Standbein des kombinierten Frachtverkehrs. Man
sieht in entwickelten Regionen der Welt wie Europa, daß dort die Küsten- und
Binnenschiffahrtswege eine wesentliche Rolle für die Effizienz eines
Wirtschaftssystems spielen. Die entwickeltsten Länder Europas profitieren von
ihrem dichten Netz von Kanälen und Flüssen, die diese miteinander und mit den
großen Häfen des Kontinents wie Rotterdam, Antwerpen und Hamburg
verbinden.
Obwohl es sich um eine langsamere Form des Verkehrs handelt als der
Transport über Straßen und Eisenbahnen, ist der Transport entlang der Küsten,
über Flüsse und Kanäle äußerst effizient - die Kosten liegen bei nur einem
Zehntel des LKW-Transports und sind nur halb so hoch wie bei im Bahnverkehr.
Die für den Nil geeigneten Schiffstypen erlauben den Transport von 40
LKW-Ladungen und mehr.
Wegen der mangelnden Infrastrukturentwicklung in der Nilregion ist die
Flußschiffahrt dort stark unterentwickelt und wird viel zu wenig genutzt, was
zu den hohen Transportkosten in der Region beiträgt. Der Ausbau der Fluß- und
Kanalinfrastruktur für die Binnenschiffahrt ergänzt sich mit Projekten zur
Nutzung des Wassers im Nilbecken für landwirtschaftliche, urbane und
industrielle Zwecke. Ein offensichtliches Beispiel ist der 60 km lange
Hauptbewässerungskanal des Toschka-Projekts, dessen Querschnitt doppelt so
groß ist wie der des Rhein-Main-Donau-Kanals. Die Sperrwerke, die die
Wasserzufuhr für die Bewässerung regeln, regeln gleichzeitig auch den
Wasserstand des Flusses, was für die Schiffahrt notwendig ist. Auch
Wasserkraftwerke bilden einen integralen Bestandteil dieser Strukturen.
Die Seefahrtkomponente beginnt an der Mittelmeerküste und dem Eingang zum
Suezkanal und führt 2200 km weit durch das Rote Meer und 8000 km weiter vom
Golf von Aden entlang der afrikanischen Küste des Indischen Ozeans. Die
zahlreichen Häfen entlang dieser Küste bilden nicht nur Tore nach Asien und
anderen Kontinenten, sondern auch eine Nord-Süd-Achse, die zur Vernetzung der
Volkswirtschaften der Region beiträgt.
An dieser Küste gibt es relativ gute Häfen, wie etwa Port Suez am südlichen
Eingang zum Suezkanal, den Hafen Sochna am Roten Meer in Ägypten und Port
Sudan im Sudan, und Dschibuti am Eingang zum Roten Meer, dem wichtigsten Hafen
für den Handel mit dem landeingeschlossenen Äthiopien. Mombasa in Kenia und
Daressalam in Tansania sind moderne Häfen, die Häfen in Eritrea und Somalia
sind jedoch schlechter ausgebaut. Wie oben erläutert, bauen die Chinesen
gerade in Lamu in Kenia nahe der somalischen Grenze einen neuen Hafen.
Viele dieser Häfen haben zwar relativ moderne Anlagen, sind aber
überlastet, und sie müssen erweitert und modernisiert werden. Das größere
Problem ist jedoch die schlechte Infrastruktur, insbesondere bei den
Bahnverbindungen ins Binnenland, weshalb sich die Fracht in den Häfen staut
und eine schnelle Be- und Entladung der Schiffe verhindert wird.
Nur die ägyptischen Häfen Alexandria und Damiette am Nildelta liegen an
schiffbaren Flüssen, in diesem Falle dem Nil.
Der längste Fluß der Welt
Der Nil ist mit mehr als 6800 km Länge der längste Fluß der Welt, er ist
fast dreimal so lang wie die gesamte Rhein-Main-Donau-Wasserstraße von
Rotterdam an der Nordsee bis zum Schwarzen Meer. Das Nilbecken geht im Süden
in die Region der Großen Seen in Ostafrika über.
Der Nil hat zwei Quellflüsse, den Blauen Nil und den Weißen Nil, die bei
Khartum im Sudan zusammenfließen. Der Blaue Nil entspringt dem Tanasee, der in
1829 m Höhe im abessinischen Hochland im Nordosten Äthiopiens liegt, und
fließt von dort aus durch steile Schluchten zunächst nach Südosten, dann nach
Süden und schließlich nach Nordwesten in den Sudan, wo er bei Khartum in den
Weißen Nil mündet, von wo aus der Nil weiter nordwärts in Richtung Mittelmeer
fließt. Aufgrund der zahlreichen Wasserfälle und Stromschnellen im Hochgebirge
ist der Blaue Nil nicht schiffbar.
Karte: UN
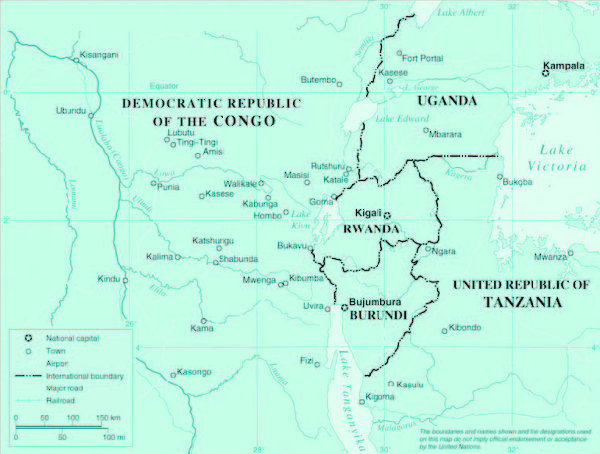
Abb. 5: Die Region der Großen Seen im Osten Afrikas
Der Weiße Nil entströmt dem Victoriasee im Grenzgebiet zwischen Uganda,
Tansania und Kenia. Er ist mit 68.000 km2 Fläche der größte See
Afrikas und der zweitgrößte Süßwassersee der Welt, und er gehört zu den Großen
Seen Ostafrikas, die wiederum Teil des Systems des Großen Afrikanischen
Grabens sind (Abbildung 5).
Westlich und südlich des Victoriasees liegt eine Kette von Seen, von Norden
nach Süden: der Kyogasee, der Albertsee, der Edwardsee, der Kivusee, der
Tanganjikasee und weiter südlich der Malawisee. Durch diese Seen ist das
Nilbecken verbunden mit Uganda, der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda,
Burundi, Kenia, Tansania und sogar Malawi und Sambia.
Der Tanganjikasee reicht mehr als 600 km weit nach Süden, wo er an den
Nordosten Sambias grenzt. Wenn man der Grenze zwischen Tansania und Sambia 300
km weiter nach Osten folgt, gelangt man nach Malawi und zur Nordspitze des
Malawisees, der sich weitere 600 km nach Süden erstreckt und dort direkt an
Mosambik grenzt, das ebenfalls am Indischen Ozean liegt und eine Landbrücke
nach Südafrika darstellt.
Anders als die Großen Seen in Nordamerika sind diese Seen nicht durch
Kanäle miteinander verbunden. Aber sie liegen in einer der fruchtbarsten
Regionen Afrikas und bilden daher Zentren der wirtschaftlichen Entwicklung.
Sie dienen schon jetzt als regionale Schiffahrtswege, aber sie müssen durch
Ausbau und moderne Häfen aufgewertet und an das Straßen- und Bahnnetz
angeschlossen werden, damit sie Teil des Nord-Süd- und Ost-West-Verkehrsnetzes
werden können.
Kommen wir zurück zum Weißen Nil, der in der Nähe von Jinga am Nordufer des
Victoriasees dem See entströmt und von dort, verstärkt durch Zuflüsse von
Westen und Osten, nach Norden fließt. Er überschreitet bei Nimule die Grenze
zum Südsudan und fließt dann weiter nach Norden, bis bei Khartum der Blaue Nil
in ihn mündet. Der Nil fließt dann weiter nach Norden durch den Nassersee und
vom Assuandamm weiter durch Ägypten nach Kairo und zu seinem riesigen Delta am
Mittelmeer. Leider ist der Nil nicht auf der ganzen Länge schiffbar. Ihn
komplett schiffbar zu machen, wäre wegen der topographischen Gegebenheiten
eine sehr große Herausforderung für die Ingenieurskunst.
Die Schiffahrt auf dem Nil beginnt erst in der südsudanesischen Hauptstadt
Juba und führt von dort bis Khartum. Im weiteren Verlauf verhindern
Stromschnellen und Wasserfälle sowie der Merowedamm die Schiffahrt, bis zum
südlichen Ende des Nassersees. Dieser Südabschnitt des Nil, wie er genannt
wird, ist mehr als 1700 km lang. Für den Südsudan, der kaum Straßen oder
Eisenbahnen hat, ist er der verläßlichste Verkehrsweg. Sein Ausbau wäre eine
große Hilfe beim Bau der Straßen und Eisenbahnen, die entlang seines Laufs
benötigt werden.
Die Fertigstellung des 370 km langen Jongleikanals zur Umgehung der
Sudd-Sümpfe zwischen Bor und Malakai würde die Schiffbarkeit enorm verbessern.
Wie schon in Teil 3 unserer Serie (Neue Solidarität 42-43/2014)
beschrieben, soll der Kanal den Sudd teilweise entwässern und die Region in
einen Brotkorb verwandeln, wobei das Fluß- und Kanalnetz als wichtige
Verkehrsarterie dienen würde.
Unterhalb von Khartum bis zur Südspitze des Nassersees verhindern mehrere
Stromschnellen die Schiffbarkeit. Der Nassersee selbst ist auf 550 km Länge
bis zum Assuandamm schiffbar, und hinter diesem ist der Strom auf weiteren
1200 km Länge schiffbar bis zum Mittelmeer.
In Ägypten bildet der Nil drei Hauptwasserstraßen. Die erste ist der 960 km
lange Stromabschnitt von Assuan bis Kairo, der am Fuß des Assuandamms beginnt.
Bei Kairo tritt der Nil in sein Delta ein und teilt sich. Ein Arm des Stroms
fließt nach Nordosten zum Hafen Damiette am Mittelmeer, von wo die Schiffe
leicht nach Port Said am Suezkanal gelangen.
Der zweite Arm führt über den 118 km langen Nubariakanal nach Alexandria,
Ägyptens wichtigstem Hafen, über den zwei Drittel der Ex- und Importe
abgewickelt werden. Die Verbesserung dieser Wasserstraße steht weit oben auf
der Prioritätsliste, nicht bloß für den Verkehr, sondern auch zur Bewässerung
von Teilen des Deltas.
Schließlich gibt es noch den Ismailiakanal, der vom Norden Kairos nach
Ismailia direkt am Suezkanal führt. Er dient vor allem der Bewässerung und
bringt außerdem Süßwasser in die Kanalzone. Er ist für die auf dem Nil
verwendeten Schiffstypen zu schmal, aber derzeit wird untersucht, wie man den
Kanal beträchtlich ausbauen könnte. Wenn man ihn für die Schiffahrt ausbaut,
würde Ismailia zu einem wichtigen Umschlagsplatz für Fracht, die für Kairo
oder andere Orte am Nil bestimmt ist.
Der Neue Suezkanal
In Ägypten werden derzeit innerhalb des Landes mehr als 90% der Güter auf
Straßen transportiert. Die Ägypter wissen, daß sich das ändern muß und daß der
einzige Weg dazu im Ausbau des Eisenbahnnetzes und der Entwicklung der
Schiffahrt liegt. Die ägyptische Regierung ist entschlossen, den Nil ganz zu
einer Nord-Süd-Achse zu entwickeln, nicht nur innerhalb Ägyptens, sondern auch
weiter nach Süden, um ihn in den großen Industrie- und Logistikkomplex zu
integrieren, der mit dem Projekt des Neuen Suezkanals entsteht.
Am Roten Meer und an der Küste des Indischen Ozeans wird die regionale
Küstenschiffahrt weiterentwickelt. Es werden neue Schiffahrtsverbindungen
geschaffen, um die Region zu vernetzen. So hat die ägyptische Regierung
beispielsweise die Fährverbindungen von Port Suez über das Rote Meer nach
Saudi-Arabien wieder aufgenommen.
Für den Nil hat die Regierung einen umfassenden nationalen Plan
ausgearbeitet, um ihn auf der gesamten Länge innerhalb des Landes auszubauen
und zu entwickeln, um die Bewässerung, Trinkwasserversorgung und die
Schiffbarkeit zu verbessern. Entlang des gesamten Stroms sind zahlreiche neue
Binnenhäfen geplant.
Der Investmentfonds Qalaa Holdings, der hierbei die Führung übernommen hat,
konzentriert sich auf Investitionen in die Infrastruktur und will das gesamte
Becken bis hinab nach Uganda entwickeln. Der Fonds hat eine Konzession
erworben, um die Rift-Valley-Eisenbahn in Kenia, Uganda und Tansania zu
betreiben. Diese noch von den britischen Kolonialherren gebaute Eisenbahn war
völlig verwahrlost, aber das Unternehmen hat sie deutlich verbessert und
erwägt sogar ihre Verlängerung bis Juba, wo ein Anschluß an die
Binnenschiffahrt auf dem Weißen Nil möglich ist.
In Ägypten baut Qalaa eine Handelsflotte von 100 motorisierten Frachtern
auf in der Absicht, die Binnenschiffart auf dem Strom und den Kanälen stark
auszuweiten.
Zusätzlich zur Entwicklung des großen Industrie- und Logistikkomplexes in
der Suezkanal-Zone, worüber wir im 1. Teil dieser Serie (Neue
Solidarität 37/2014) berichteten, hat die ägyptische Regierung soeben
angekündigt, daß sie in Damiette ein Zentrum für die Getreide- und
Nahrungsmittellogistik von Weltrang aufbauen will, das die gesamte Region
beliefern soll. Premierminister Ibrahim Mehleb nannte es „ein nationales
Großprojekt, das nicht weniger wichtig ist als das Suezkanal-Projekt“. Geplant
ist, den Hafen so auszubauen, daß dort Schiffe mit einer Ladung von 150.000 t
Getreide abgefertigt werden können, hinzu kommen Anlegestellen für die
kleineren Fluß- und Kanalschiffe. Das Projekt soll die Kapazität der
ägyptischen Häfen von heute 2,5 Mio. t auf 10 Mio. t vergrößern. Gleichzeitig
sollen dort nahrungsmittelverarbeitende Betriebe angesiedelt werden.
Schlußbemerkung
Indem die ägyptische Regierung längst aufgegebene Entwicklungsprogramme
wieder anpackt, hat sie im Land eine Welle des Optimismus ausgelöst, die ganz
Afrika erfassen kann. Aber das läßt sich von der gewaltigen weltweiten
Veränderung, die sich seit einigen Jahren vollzieht, nicht trennen. Die
Initiativen Chinas und der BRICS-Gruppe zur Schaffung der Grundlage für eine
neue Weltordnung auf der Grundlage wirtschaftlicher Kooperation und Achtung
der Souveränität und Unabhängigkeit aller Nationen haben den Weg für diese
wichtigen Entwicklungen bereitet.
Wie die hier berichteten Fakten deutlich machen, hat China vor Ort bereits
zahlreiche bahnbrechende bilaterale und multilaterale Verträge über Projekte
zur wirtschaftlichen Entwicklung der Nationen des Nilbeckens und Ostafrikas
geschlossen. Leider verfolgen die Vereinigten Staaten, Großbritannien und ihre
Verbündeten in Europa schon lange eine Politik der „kreativen Zerstörung“
gegenüber Afrika. Der Krieg in Libyen 2011, in dem von Saudi-Arabien und Katar
unterstützte Al-Kaida-Gruppen Seite an Seite mit der NATO kämpften, hat dieses
Land in Schutt und Asche gelegt, und die Kämpfe haben sich inzwischen auf
Mali, Algerien und Nigeria ausgeweitet.
Die Unterstützung der Regierung Obama für die Muslimbruderschaft in Ägypten
hätte auch dieses Land beinahe in einen blutigen Bürgerkrieg gestürzt. Nun
kämpft Ägypten im Sinai im Osten gegen die Terroristen und muß gleichzeitig
die von Libyen ausgehende Terrorgefahr abwehren.
Die gescheiterte Politik des Westens am Horn von Afrika hat in den letzten
Jahrzehnten mit Somalia einen gescheiterten Staat hervorgebracht, der nicht
nur im Innern blutet, sondern auch international zu einer Bedrohung für die
Sicherheit geworden ist, besonders für Kenia, aber auch für die
internationalen Handelsrouten im Arabischen Meer und im Golf von Aden vor der
somalischen Küste, wo Piratenbanden operieren. Die mit Al-Kaida verbundene
somalische Terrorgruppe Al-Schabab hat ihre Terroranschläge in Kenia
verstärkt, seit dieses Land mit China Verträge über den Bau des Hafens von
Lamu und des Lamu-Korridors abgeschlossen hat. Somalia ist kein hoffnungsloser
Fall, aber seine Rettung ist nur im Rahmen der Wende in den internationalen
Beziehungen und der realen Entwicklung der umliegenden Region erreichbar.
Der Optimismus in Ostafrika muß auch nach Westafrika und in den ganzen
übrigen Kontinent verbreitet werden - und dazu muß verhindert werden, daß sich
das Ebola-Virus von Westafrika nach Osten ausbreitet. Alle internationalen
Bemühungen sind darauf auszurichten, die Bedrohung durch Ebola einzudämmen und
zu beseitigen - zusammen mit der eigentlichen Ursache, nämlich der
Unterentwicklung der Region. Und dazu brauchen wir, wie Helga Zepp-LaRouche
kürzlich bei der Konferenz des Schiller-Instituts in Deutschland wieder
erklärte, eine neue, gerechte Weltwirtschaftsordnung.

