Den Krieg beenden durch den Aufbau des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße
Teil 4a: Die Integration der Verkehrsinfrastruktur im Nilbecken
Von Hussein Askary und Dean Andromidas
Wenn wir Epidemien wie Ebola, Hungersnöte und Massenflucht aus Afrika in
der Zukunft verhindern wollen, dann brauchen wir neben einer internationalen
Mobilisierung gegen die schreckliche Ebola-Epidemie in Westafrika auch einen
dauerhaften und umfassenden Entwicklungsansatz. Mit den Entwicklungen in
Ägypten, Äthiopien und nun auch Nationen weiter südlich am Nil (siehe Teile
1-3, Neue Solidarität 37, 38 und 42-43/2014) sieht man jetzt in
Ostafrika und am Nilbecken nach einer langen, finsteren Nacht einen
Hoffnungsschimmer am Horizont. Aber dieser Prozeß muß aufrechterhalten und
durch internationale Maßnahmen unterstützt werden, damit er nicht im Keim
erstickt wird, so wie die großen Träume der Afrikaner von Unabhängigkeit und
Entwicklung in den 1960er Jahren im Blut der afrikanischen Völker und ihrer
besten Staatsmänner ertränkt wurden. Was danach kam, war eine endlose Abfolge
von Bürgerkriegen, Hungersnöten, Epidemien und ein indirekter Massenmord des
transatlantischen Systems an den Afrikanern durch das systematische Verweigern
moderner Technik und medizinischer Versorgung. Gleichzeitig verlor Afrika
Arbeitskräfte durch die Massenflucht nach Europa, Rohstoffe, für die im
Austausch Waffen kamen, und enorme Geldsummen, die Diktatoren und Kriegsherren
in britische und schweizerische Banken und Finanzinstitute schafften.
Nun aber entsteht mit den Initiativen der BRICS-Staaten (Brasilien,
Rußland, Indien, China und Südafrika) die konkrete Aussicht auf die „neue,
gerechte Weltwirtschaftsordnung“, für die sich Lyndon LaRouche und seine
internationale Bewegung seit Jahrzehnten einsetzen, und Afrika ist nicht
länger Geisel seiner alten Kolonialherren und deren heutigen Instrumenten der
Versklavung, wie Weltwährungsfonds (IWF), Weltbank und „grüne“ Organisationen
wie der World Wildlife Fund.
Mit der Neuen Entwicklungsbank (NDB) der BRICS-Staaten und der von China
initiierten Asiatischen Infrastruktur-Investitionsbank (AIIB) wurde ein neuer
Entwicklungsansatz ins Leben gerufen, der ganz anders ist als der von Weltbank
und IWF, dafür aber den besten amerikanischen und europäischen Traditionen
(wie der von Franklin Roosevelt und von Charles de Gaulle) ähnlich ist.
Die Maßeinheit des Handelns
Die regionale Integration gehört seit den 1960er Jahren schon immer zur
Strategie der afrikanischen Nationen für die wirtschaftliche Transformation,
und es wurden dazu internationale Vereinbarungen geschlossen wie z.B. der
Lagos-Aktionsplan (1980) und der Vertrag von Abuja (1991). Aber sie wurden nie
verwirklicht. Das kann sich nun jedoch ändern. Für Afrika ist die Afrikanische
Union (AU) die natürliche Einheit der infrastrukturellen und politischen
Integration. Aber die regionalen Strukturen müssen Teil einer Vision der AU
werden, die von realwirtschaftlichen Überlegungen ausgeht, nicht von
ideologischen, religiösen, ethnischen, politischen oder auch
finanziell-monetären.
Eine Strategie für wirtschaftliche Entwicklung muß die Fähigkeit der Region
verbessern, eine „realwirtschaftliche Wirkungseinheit“ zu schaffen, wie Lyndon
LaRouche es nennt. In seinem Aufsatz „Das Eine ist der Ursprung seiner Teile“
(Neue Solidarität 2/2008) erklärt LaRouche:
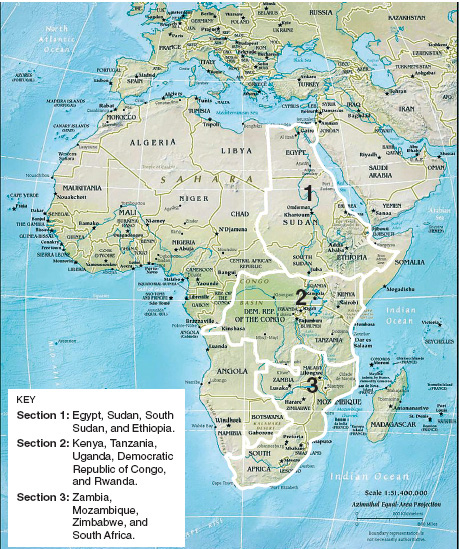
Abb. 1: Die drei Abschnitte des Nord-Süd-Korridors
Abb. 2: Die zehn Staaten des Nilbecken
„Die Maßeinheit des Handelns besteht dabei im relativen Anstieg oder
Rückgang der potentiellen relativen Bevölkerungsdichte der jeweiligen
einzelnen oder kombinierten Systeme als interagierendes Ganzes. Diese
Wirkungseinheit ist im wesentlichen ,Wernadskijisch’, d.h. dies ist ein sowohl
kultureller als auch physischer Anstieg oder Rückgang der potentiellen
relativen Bevölkerungsdichte pro Kopf und pro Quadratkilometer der
betreffenden nationalen, kontinentalen oder globalen Gesamtsysteme. Die
entsprechende Handlungsweise liegt in jener Fähigkeit des individuellen
menschlichen Geistes, die den menschlichen Geist von den Tieren unterscheidet
und die Menschheit als eine Kategorie definiert, die in Begriffen der
Noosphäre, nicht bloß der Biosphäre handelt.“
Dabei spielt die Infrastruktur im allgemeinen und die Verkehrsinfrastruktur
im besonderen eine entscheidende Rolle. In diesem Teil unseres Berichtes
beschreiben wir die entscheidende Triade der notwendigen Infrastrukturprojekte
für den Verkehr: Straßen, Eisenbahnen und Wasserstraßen in der Region des
Nilbeckens.
Schaffung einer starken Nord-Süd-Achse
Das Nilbecken und Ostafrika sind Teil einer potentiell sehr mächtigen
Nord-Süd-Entwicklungsachse, welche die beiden am weitesten entwickelten, an
den entgegengesetzten Enden des Kontinents liegenden Länder, nämlich Ägypten
und Südafrika, miteinander verbinden könnte. Die natürlichen Umgrenzungen
dieser Achse sind im Osten das Rote Meer und der Indische Ozean, im Nordwesten
die Weiten der Sahara-Wüste, im Südosten das Kongobecken in Zentralafrika, im
Norden Ägypten und im Süden Südafrika.
Diese Achse läßt sich in drei Abschnitte unterteilen (Abbildung1 und
2):
Die nördliche Region umfaßt Ägypten, Nord- und Südsudan und Äthiopien.
Letzteres bildet die Ostgrenze des Nilbeckens und blickt auf das Rote Meer,
den Golf von Aden und den Indischen Ozean, hat jedoch keinen direkten Zugang
zu diesen Meeren, weil Eritrea, Dschibuti und Somalia dazwischen liegen. In
Äthiopien liegt auch die Quelle des Blauen Nil am Tana-See.
Den zweiten Teil der Achse bildet Ostafrika mit Kenia und Tansania am
Indischen Ozean und Uganda, der Demokratischen Republik Kongo, Ruanda und
Burundi im Landesinnern. Diese Region bildet den sogenannten Östlichen Graben
mit den Großen Seen Afrikas, von denen der größte, dem der Weiße Nil
entspringt, leider immer noch nach der britischen Königin Victoria benannt
ist.
Den dritten Abschnitt bildet die Ostflanke des südlichen Afrika mit Sambia,
Mosambik, Simbabwe und Südafrika.
Mit seinem großen Reichtum an Wasser, fruchtbarem Land, Mineralien, Öl- und
Gasvorkommen und ungenutztem Wasserkraftpotential sowie einer großen und
jungen Bevölkerung ist das Nilbecken und Ostafrika gut aufgestellt, im 21.
Jahrhundert zu einer bedeutenden wirtschaftlichen Kraft aufzusteigen. Bisher
jedoch sind diese Ressourcen weitgehend ungenutzt, sie müssen besser
organisiert, vereinheitlicht und vereint werden, um aus den verschiedenen
Ressourcen den größtmöglichen Nutzen ziehen zu können.
So kann man beispielsweise mit einem „multimodalen“ Verkehrsnetz die
Produktivität aller dieser Volkswirtschaften verbessern und den Aufwand an
Zeit, Energie und Arbeitskraft verringern. Ein multimodales Verkehrsnetz ist
eine Kombination von zwei oder mehr Verkehrsmitteln - Straßenverkehr,
Eisenbahnen, Schiffsverkehr und/oder Lufttransport -, durch die eine
integrierte Transportkette entsteht, welche die jeweiligen Vorteile der
verwendeten Verkehrsmittel nutzt.
Das charakteristischste Element eines solchen Systems sind
Umschlagsterminals, die ihm Schnelligkeit und Effizient verleihen, wenn die
Fracht, beispielsweise Container (aber nicht Massengüter wie Öl, Holz oder
Getreide) in kürzester Zeit und mit dem geringsten Aufwand vom Schiff auf den
Zug oder einen LKW umgeladen werden. Darüber hinaus können Absender und
Empfänger den Weg des Containers und seine Position über digitale Systeme aus
der Ferne verfolgen. Man benötigt hierzu u.a. standardisierte Größen von
Containern, Kränen und Bahnspurweiten, damit die Güter mit der Bahn durch
verschiedene Länder und Terminals verfrachtet werden können. Darunter müssen
auch Kühlcontainer und Kühllager sein - ein ganz wesentlicher Faktor für den
Transport landwirtschaftlicher Güter in diesem Teil der Welt, weil bisher ein
Großteil davon auf dem Weg zu den Märkten verdirbt.
Nichts davon ist im Becken des Nil vorhanden, außer in begrenztem Umfang in
Ägypten, wo internationale Fracht umgeschlagen wird. Ägypten nimmt hier eine
besondere Rolle ein, denn es ist sowohl ein Teil der Eurasischen Landbrücke
als auch - durch den Suezkanal - ein Teil der Maritimen Seidenstraße, und es
ist über das Mittelmeer mit Europa verbunden. Außerdem hat Ägypten über die
Halbinsel Sinai eine Landverbindung nach Asien.
Das koloniale Erbe
Die bestehenden Verkehrsnetze in der Region wurden in der Kolonialära dazu
geschaffen, den Reichtum dieser Länder an Mineralien und Agrarprodukten nach
Übersee auszuführen, sie sollten aber keine Verbindungen zwischen diesen
Ländern herstellen. Die Briten und anderen Kolonialherren benutzten die
Eisenbahnen, um die Region zu plündern, und die Bahnen haben unterschiedliche
Spurweiten, nicht bloß in verschiedenen Ländern, sondern oft auch innerhalb
desselben Landes. Doch selbst diese, für die Entwicklung der Länder nur
beschränkt nützlichen Bahnen wurden aus Mangel an Instandhaltung und
Investitionen weitgehend aufgegeben. In Kenia ist nur noch die Hälfte von
einst 2730 km Gleisanlagen in Betrieb.
Die Eisenbahn ist das kostengünstigste Verkehrsmittel für den Transport von
Massengütern über größere Landstrecken, und sie ist gut geeignet für den
Transport von Containern zwischen den Seehäfen und den Städten im
Landesinneren. Die zehn Staaten des Nilbeckens haben zusammengenommen ein
Eisenbahnnetz von 23.059 km. Indien hat im Vergleich dazu 115.000 km und China
103.000 km Eisenbahnstrecken (2013). In Burundi und Ruanda gibt es überhaupt
keine Eisenbahn. Die Bahnen in der Region sind im allgemeinen sehr
ineffizient, sie haben lange Fahr- und Wartezeiten und arbeiten weit unter
ihrer Kapazität. Am häufigsten wird die Schmalspurweite von 1,067 m verwendet,
außer in Ägypten, wo man die breite (europäische) Standardspurweite von 1,435
m nutzt. Die Bahnen haben meistens nur ein einziges Gleis mit einer
beschränkten Achslast und niedrigen Geschwindigkeiten. Keines der nationalen
Bahnnetze ist für Verbindungen über Landesgrenzen hinweg angelegt, sie sind
also auch im besten Fall nur Inseln.
Alle diese Hindernisse und Unzulänglichkeiten und das koloniale Erbe
verhinderten eine durch wirtschaftliche Verflechtungen geförderte politische
Integration dieser Nationen. Damit gäbe es ganz andere Voraussetzungen für
Konfliktlösung und Frieden, anstelle der grenzüberschreitenden Konflikte und
Intrigen, die immer wieder zu furchtbaren Massakern an Menschen in der Region
geführt haben.
Landeingeschlossen
Die Tatsache, daß die meisten Nationen im Nilbecken landeingeschlossen
sind, hat die wirtschaftliche Entwicklung und die Integration dieser Nationen
mit anderen Regionen behindert. Neben der von außen erzwungenen mörderischen
Wirtschafts- und Militärpolitik leiden die Länder des oberen Nilbeckens vor
allem unter den hohen Kosten des Straßenverkehrs und der Logistik, die ihre
wirtschaftlichen Möglichkeiten stark einengen. Weil der Transport innerhalb
und zwischen diesen Ländern meist mit Lastwagen über sehr schlecht gebaute und
instandgehaltene Straßen abgewickelt wird, gehören die Transportkosten in
dieser Region zu den höchsten weltweit.
Besonders groß sind die Herausforderungen für die Hälfte der Nationen des
Nilbeckens, die landeingeschlossen sind: Ruanda, Burundi, Uganda, die
Demokratische Republik Kongo, Südsudan und Äthiopien. So betragen
beispielsweise die Kosten für den Transport eines Containers mit Düngemitteln
von Singapur zum Hafen Alexandria in Ägypten 4000 $, zum Hafen Mombasa in
Kenia 5000 $, nach Kampala in Uganda 8400 $, nach Kigali in Ruanda 10.400 $
und nach Bujumbura in Burundi 10.600 $ (Quelle: Maersk 2011/Nile Basin
Initiative).
Noch wichtiger ist, daß der Handel und Transfer von Gütern und Maschinen
zwischen Nachbarländern - der Integration und wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung fördert - enorm darunter leidet, daß die Verkehrsverbindungen
zwischen diesen Nationen nicht standardisiert oder überhaupt nicht existent
sind. Das Fehlen billiger und effizienter Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen
durch Eisenbahn- und Schiffahrtswege hat die wirtschaftliche Integration in
der Region des Nilbeckens massiv behindert.
So gehen beispielsweise zwei Drittel der ägyptischen Exporte in der
Nilregion nach Sudan und Südsudan, aber nicht einmal 1% in die acht weiter
flußaufwärts gelegenen Nationen! Von den Exporten des Sudan gehen nur 2,2% in
diese Länder. Ähnlich machen die Importe aus den Nationen des Nilbeckens nach
Ägypten nur 0,6% aller Importe aus - im Sudan sind es 12%, in Äthiopien
3%.
China baut Wirtschaftskorridore
Während einer Rundreise durch mehrere afrikanische Länder beschrieb Chinas
Premierminister Li Keqiang im Mai 2014 eine optimistische Vision eines von
China unterstützten industriellen und infrastrukturellen Wachstums auf dem
afrikanischen Kontinent. Die Reise begann in Äthiopien und endete in Kenia,
und sie führte durch Nigeria, Chinas drittgrößten Handelspartner in Afrika,
und Angola, den größten afrikanischen Handelspartner. Anders als westliche
Medien frustriert und nervös berichteten, ging es Li nicht in erster Linie
darum, Rohstoffe einzukaufen. Er setzte sich vielmehr dafür ein, Chinas
industrielle Investitionen und von China unterstützte
Infrastrukturinvestitionen in Afrika auszuweiten - eine Politik, die den
Lebensstandard heben und Afrika in eine neue wirtschaftliche Geometrie bringen
wird.
In seiner Rede am Sitz der Afrikanischen Union im äthiopischen Addis Abeba
betonte Li am 5. Mai, eines von Chinas Zielen sei die Verwirklichung des
Traumes, alle afrikanischen Hauptstädte durch Hochgeschwindigkeitsbahnen
miteinander zu verbinden, um die panafrikanische Kommunikation und Entwicklung
zu fördern. China habe in dem Bereich Technik von Weltrang entwickelt, sagte
Li, und sein Land sei bereit, mit Afrika zusammenzuarbeiten, um diesen Traum
wahr zu machen. Direkt gegen alle diejenigen gerichtet, die solche Projekte
für „utopisch“ halten, sagte er, mit Chinas Unterstützung sei dies sehr wohl
ein machbares Ziel.
Dies ist das erste Mal, daß sich ein führendes Land der Welt für einen Plan
zu einem schnellen industriellen und infrastrukturellen Aufbau Afrikas
einsetzt, seit Lyndon LaRouche 1979 eine Studie erstellen ließ, in der ein
schneller Aufbau von Infrastruktur - u.a. ein kontinentales Eisenbahnnetz,
ehrgeizige Wasserprojekte und Kernkraftwerke - und Industrie in Afrika
beschrieben und gefordert wurde.
Wie wir in diesem Bericht zeigen werden, bildet China tatsächlich die
Speerspitze beim Ausbau der Verkehrsinfrastruktur im Nilbecken.
Das bedeutendste Ereignis während Lis Rundreise war die Unterzeichnung
eines Abkommens in Kenia am 11. Mai 2014 zwischen der chinesischen Delegation
und den Staatschefs der Ostafrikanischen Gemeinschaft (EAC) über den Bau einer
Eisenbahn in Kenia von der Hafenstadt Mombasa am Indischen Ozean zur
Hauptstadt Nairobi für umgerechnet 3,8 Mrd.$. Dies ist aber nur der erste
Abschnitt einer Strecke, die letztlich nach Uganda, Ruanda, Burundi und
Südsudan weiterführen wird. Unter der Vereinbarung finanziert Chinas
Export-Import-Bank 90% der Kosten dafür, die verfallenen Gleise aus der
britischen Kolonialzeit durch eine 609 km lange Bahnstrecke mit
Standardspurweite zu ersetzen. Kenia wird die übrigen 10% finanzieren. Der Bau
soll unter der Leitung der China Communications Construction Co. (CCCC) noch
in diesem Jahr beginnen und nach dreieinhalb Jahren fertiggestellt werden.
Die Reisezeit auf der neuen Linie Mombasa-Nairobi soll sich damit von
derzeit zwölf Stunden Fahrt auf überlasteten, von Schlaglöchern übersäten
Straßen auf etwa vier Stunden reduzieren. Güterzüge sollen die bisher rund 36
Stunden lange Fahrt in nur noch 8 Stunden bewältigen können, was auch
bedeutet, daß die Frachtkosten um 60% sinken werden.
Wenn die Strecke Mombasa-Nairobi fertiggestellt ist, sollen die Bauarbeiten
weitergehen, um die größte Volkswirtschaft Ostafrikas mit den Hauptstädten
Kampala (Uganda), Kigali (Ruanda), Bujumbura (Burundi) und Juba (Südsudan) zu
verbinden.
An der feierlichen Unterzeichnung nahmen neben Li und dem kenianischen
Präsidenten Uhuru Kenyatta auch Ugandas Präsident Yoweri Museveni, Ruandas
Präsident Paul Kagame, Südsudans Präsident Salva Kiir und hochrangige
Vertreter Burundis und Tansanias teil. „Dieses Projekt demonstriert, daß es
eine gleichberechtigte Kooperation zum gegenseitigen Nutzen zwischen China und
den ostafrikanischen Ländern gibt, und die Eisenbahn ist ein sehr wichtiger
Teil der Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur“, sagte Premierminister Li.
Präsident Kenyatta sagte, das Projekte „beruht auf gegenseitigem Vertrauen“,
Kenia habe „in China einen ehrenwerten Partner gefunden“. Und mit einem
Seitenhieb auf die westlichen Nationen sagte Museveni: „Wir sind froh, zu
sehen, daß sich China auf die eigentlichen Inhalte der Entwicklung
konzentriert... Sie halten uns keine Vorträge darüber, wie wir vor Ort unsere
Regierungen führen sollen.“
Das Abkommen ist Teil einer ganzen Serie von Vereinbarungen, die China
geschlossen hat, um Entwicklungskorridore zu schaffen, die Ostafrikas
Volkswirtschaften ins 21. Jahrhundert katapultieren. Diese Projekte sind der
Korridor vom Hafen Lamu nach Südsudan und Äthiopien (LAPSSET-Projekt), der
schon erwähnte Nordkorridor und der Zentralkorridor. Sie alle gehören zum
„Ostafrikanischen Eisenbahn-Generalplan“, einem Vorschlag zur Erneuerung
bestehender Bahnen in Tansania, Kenia, Uganda und ihrer Verlängerung nach
Burundi, Ruanda, Südsudan und Äthiopien, sowie weiterer Verbindungen nach
Nord- und Westafrika durch die Demokratische Republik Kongo, den Sudan und
Ägypten (Abbildung 3).
Karte: EAC/CPCS Transcom
Abb. 3: Die Projekte des Ostafrikanischen Eisenbahn-Generalplans
Karte: ERC
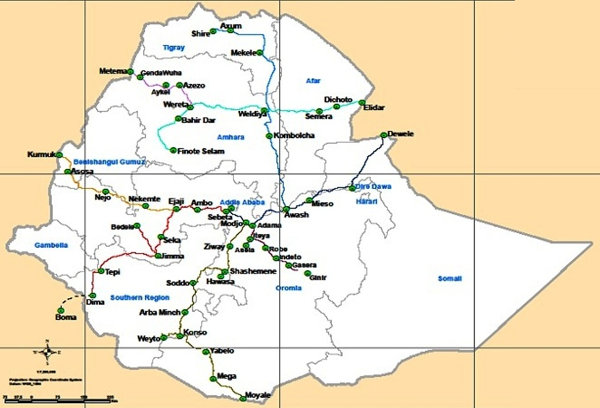
Abb. 4: Die Projekte des Fünfjahresplans für Wachstum und Transformation
der äthiopischen Regierung
Der Abschlußbericht über diesen Generalplan, den die Ostafrikanische
Gemeinschaft in Auftrag gegeben hatte, wurde 2009 vom kanadischen Unternehmen
CPCS Transcom aus Ottawa erstellt. Aber wie viele andere Projekte in Afrika
blieb er in der Schublade liegen, weil die westliche Welt keine Unterstützung
und Finanzierung geben wollte - bis dann China auftrat. Die Kosten dieser
Projekte - bis zu 40 Mrd. $, vielleicht noch mehr - übernehmen nun
offensichtlich weitgehend China und andere BRICS-Staaten wie Indien, das
ebenfalls Interesse daran zeigt, die Entwicklung Ostafrikas zu unterstützen.
Und alle Projekte sollen schon 2018 vollendet sein! Das bedeutet, daß
Ostafrika in den kommenden Jahren eine der größten Baustellen der Welt sein
wird, mit neuen Industrie- und Wirtschaftszonen und Handelszentren, die als
Ableger dieser Hauptprojekte entstehen werden.
China wird in mehreren Ländern gleichzeitig Eisenbahnen mit
Standardspurweite bauen. 2013 unterzeichnete die staatliche China Harbor
Engineering Co. (CHEC) einen 8-Mrd.-$-Auftrag der ugandischen Regierung für
Modernisierung und Ausbau der bestehenden Strecken von Malaba an der Grenze zu
Kenia nach Kampala (von Osten nach Westen) sowie von Malaba nach Gulu mit
Verlängerung nach Nimule an der Grenze zum Sudan (von Südosten nach Norden).
Die Bahn hat die Standardspurweite, wo der Abstand zwischen den Innenkanten
der Gleise 1,435 m beträgt. Von dort soll das Bahnnetz nach Juba im Südsudan
verlängert werden. Das Projekt ist Teil des Nordkorridors der EAC. Als Teil
des Vertrags wird die CHEC eng mit dem Pionierkorps der ugandischen Armee
zusammenarbeiten, das sich an der Ausführung der Arbeiten beteiligt, und sie
wird auch in Uganda eine Technische Hochschule zur Ausbildung weiterer
Armeeangehöriger als Ingenieure und Techniker aufbauen.
Die CHEC hat bekanntgegeben, daß auch die Regierung des Südsudan das
Unternehmen ausgewählt hat, das Eisenbahnnetz des Landes zu modernisieren und
erweitern.
Auch Äthiopien hat chinesische Unternehmen engagiert, um sein Eisenbahnnetz
in Standardspurweite auszubauen. Innerhalb von 3-5 Jahren will Äthiopien eines
der modernsten Bahnnetze Afrikas haben. 2011 schloß die staatliche Äthiopische
Eisenbahngesellschaft (ERC) zwei Vereinbarungen mit chinesischen Unternehmen,
um ein Streckennetz von 4744 km Länge aufzubauen. Dieses Netz wird 50
städtische Zentren in allen Bundesstaaten Äthiopiens sowie an den Grenzen zu
Sudan, Kenia und Dschibuti miteinander verbinden. Das Vorhaben ist Teil des
Fünfjahresplans für Wachstum und Transformation (GTP) der äthiopischen
Regierung (Abbildung 4).
Im Dezember des gleichen Jahres unterzeichnete die ERC einen Vertrag mit
der China Civil Engineering Construction Co. (CCECC) über den Bau der 339 km
langen Eisenbahnstrecke Mieso-Dire Dawa-Dewele als Teil des Eisenbahnprojekts
Addis-Abeba-Dire Dawa- Dschibuti. Die Verlegung der Gleise begann im Mai
dieses Jahres und die Strecke soll schon 2015 fertiggestellt werden. Die
Gesamtlänge der elektrifizierten Eisenbahnstrecke beträgt 740 km, und sie wird
den Transport von Gütern und Passagieren von der äthiopischen Hauptstadt zum
Hafen Tadjoura im benachbarten Dschibuti ermöglichen. Die Reisezeit zwischen
den beiden Endpunkten wird sich bei einer vorgesehenen Reisegeschwindigkeit
von 120 km/h auf weniger als zehn Stunden halbieren. In der Anfangsphase
werden 540 km der Strecke zunächst nur eingleisig gebaut.
Dschibuti ist heute das wichtigste Tor Äthiopiens zu den internationalen
Märkten, weil dieses durch den Eritreisch-Äthiopischen Krieg, der 1998 begann,
seinen Zugang zum eritreischen Hafen Assab am Roten Meer verloren hat. Aber
der Bau der Eisenbahn bedeutet nicht bloß die Schaffung eines Handelsweges,
sondern er ist Teil eines Entwicklungsplans für das äthiopische Hinterland.
Indien, ein weiteres Mitglied der BRICS, hat sich im Juni 2013 durch eine
300-Mio.-$-Kreditlinie der indischen Export-Import-Bank an diesem
äthiopisch-dschibutischen Projekt beteiligt.
Im Juni 2012 haben die ERC und die CCCC auch einen 1,5-Mrd.-$-Vertrag über
den Bau einer 268 km langen Bahnstrecke im Norden Äthiopiens unterzeichnet.
Die Strecke wird von Mekelle-Woldya nach Hara Gebeya führen. Das Projekt
verbindet den Norden des Landes mit der Strecke Addis Abeba-Dschibuti.
Alle diese Fortschritte im Nilbecken und in Ostafrika zeigen, daß
tatsächlich der Wille besteht, in friedlicher Zusammenarbeit zwischen diesen
Nationen einen wirklichen Entwicklungsprozeß in Gang zu setzen. Dank der
Beteiligung Chinas sind auch die notwendigen Mittel vorhanden, dies zu
verwirklichen. Und deshalb man muß auch nicht um die Erlaubnis oder die
Finanzierung des Weltwährungsfonds, der Weltbank, der USA oder der EU bitten,
die bei der gegenwärtigen Einstellung des Westens auch gar nicht bereit wären,
sich an einem so großen Aufbauprogramm zu beteiligen.
Straßennetz
Derzeit ist der Straßenverkehr die vorherrschende Transportart in der
Nilregion. 80% des Güterverkehrs und 90% des Passagierverkehrs in der Region
werden über Straßen abgewickelt. Bei den über Straßen transportierten Gütern
handelt es sich meist um landwirtschaftliche Produkte und lokal hergestellte
Waren, wie etwa Mais und anderes Getreide, Mehl, Zucker, Reis, Bier, Kaffee,
Tee, Tabak, Salz, Gips, Kalkstein, Zement, Erdölprodukte, Silikate und
gewalztes Eisen. Im internationalen Verkehr exportiert man Waren wie Kaffee,
Leder und Felle, Fisch, Tabak, Baumwolle, Ölsaaten, Getreidemehl, Mineralien
und Gemüseprodukte auf die Weltmärkte, aus dem Ausland kommen Erdölprodukte,
Zement, Weizen, Palmöl, Eisen und Stahl, Kleidung, Zucker, Keramikfliesen und
Motorfahrzeuge. Der Transport erfolgt meistens durch Lastwagengespanne und
Tankfahrzeuge. Wie schon erwähnt, ist dies mit hohen Transportkosten verbunden
und sehr ineffizient.
In der Nilregion gibt es etwa 650.000 km Straßen, was sieben
Straßenkilometer pro 100 km2 entspricht. Das ist sehr wenig im
Vergleich zu anderen Entwicklungsregionen wie Lateinamerika (12 km je 100
km2) und Asien (18 km je 100 km2). Noch dramatischer ist
der hohe Anteil der unbefestigten Straßen: der Südsudan hat nur 7000 km
Straßen, und davon sind ganze 1% befestigt. Ruanda hat 12.000 km Straßen,
davon 8% befestigt, Uganda 41.000 km (4%), Kenia 160.000 km (7%). Den höchsten
Anteil befestigter Straßen hat Ägypten mit 73% von insgesamt 65.000 km
Straßen. In der ganzen Region sind nur 86.600 km Straßen befestigt.
Das wachsende Frachtvolumen auf großenteils unzureichenden Verkehrswegen
führt zu immer größerer Überlastung der Wege und einem weiteren Verfall der
ohnehin schon schlechten Straßen. Die meisten Straßen werden nur sehr schlecht
instandgehalten, weshalb viele in der Regenzeit unpassierbar sind. Der
Südsudan, wo es jedes Jahr zu großen Überschwemmungen kommt, hat den größten
Anteil an Straßen, die in der Regenzeit nicht benutzbar sind. Die Zahl der
Verkehrsunfälle in der Region ist sehr hoch. Außerdem leidet der
Straßenverkehr auch daran, daß die zulässige Achslast der LKW oft
überschritten wird, was den Verfall der Straßen noch weiter beschleunigt,
zudem an Verzögerungen insbesondere in den Seehäfen, an Fahrzeugwaagen,
Grenzkontrollstellen und Umschlagsplätzen im Landesinneren, was alles die
Transportkosten erhöht.
Die Kosten des Straßentransports von Massengütern (pro 1000 km gerechnet)
liegen um das Drei- bis Vierfache über den Kosten des Transports mit
Eisenbahnen oder Binnenschiffen - zum Teil sogar noch höher. Außerdem sind die
Möglichkeiten, die Kosten durch Mengensteigerung zu verringern, sehr begrenzt.
All dies behindert die Industrialisierung der Länder und die
Effizienzsteigerung ihrer Landwirtschaft.
wird fortgesetzt

