Den Krieg beenden durch den Aufbau des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße
- Teil 3 -
Von Hussein Askary und Dean Andromidas
„Ihr seid alle jung im Geiste“, erwiderte der [ägyptische] Priester, „denn
ihr tragt in ihm keine Anschauung, welche aus alter Überlieferung stammt, und
keine mit der Zeit ergraute Kunde. Der Grund hiervon aber ist folgender: Es
haben schon viele und vielerlei Vertilgungen der Menschen stattgefunden und
werden auch fernerhin noch stattfinden, die umfänglichsten durch Feuer und
Wasser...
Von derselben [Vernichtung durch Feuer] werden dann die, welche
auf Gebirgen und in hochgelegenen und wasserlosen Gegenden wohnen, stärker
betroffen als die Anwohner der Flüsse und des Meeres, und so rettet auch uns
der Nil, wie aus allen andern Nöten, auch dann, indem er uns auch aus dieser
befreit. Wenn aber wiederum die Götter die Erde, um sie zu reinigen, mit
Wasser überschwemmen, dann bleiben die, so auf den Bergen wohnen, Rinder- und
Schafhirten, erhalten; die aber, welche bei euch in den Städten leben, werden
von den Flüssen ins Meer geschwemmt; dagegen in unserem Lande strömt weder
dann noch sonst das Wasser vom Himmel herab auf die Fluren, sondern es ist so
eingerichtet, daß alles von unten her über sie aufsteigt. Daher und aus diesen
Gründen bleibt alles bei uns erhalten und gilt deshalb für das
Älteste...“
– Platon, Timaios1
Karte: UNEP/Philippe Rekacewicz
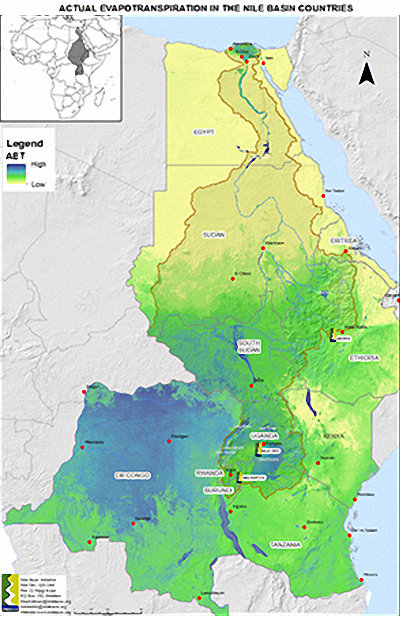
Abb. 1: Im Einzugsbereich des Nil liegen acht afrikanische Staaten
Es hat seine Gründe, daß die Ägypter besorgt sind, wenn von Staudämmen oder
anderer Wasserinfrastruktur in der Region der Großen Seen Ostafrikas und am
Oberlauf des Nil die Rede ist. Diese Wiege der antiken Zivilisation verdankte
ihre Existenz schon immer dem Wasser des Nil, und das wird auch so bleiben.
Wie schon im zweiten Teil dieser Serie erwähnt wurde (Neue Solidarität
38/2014), sind die Ägypter daher auch besorgt über die Entscheidung
Äthiopiens, am größten Quellfluß des Nil, dem Blauen Nil, den Großen
Äthiopischen Renaissance-Damm (GERD) zu bauen.
Ägypten ist fast völlig vom Nilwasser abhängig; das teilt es sich mit
sieben anderen afrikanischen Staaten (Abb. 1), von denen jeder seinen
eigenen Bedarf und seine eigenen Entwicklungspläne hat. Das Abkommen von 1959
über die Nutzung des Nilwassers zwischen dem Sudan und Ägypten gibt diesen
beiden Ländern das Recht, 85% der jährlichen Wasserführung des Nil am
Zusammenfluß von Weißem Nil und Blauem Nil (bei der sudanesischen Hauptstadt
Khartum) zu nutzen. Demnach kann der Sudan 18,5 Mrd. m3 Wasser
nutzen, und Ägypten 55,5 Mrd. m3. Die Zahlen sind jedoch
irreführend, weil fast achtmal mehr Wasser verdunstet oder ungenutzt
abfließt.
Dieses Abkommen wurde zu einem Streitpunkt, denn die anderen
Anliegerstaaten des Nil fordern ein neues Abkommen, das die Nutzungsrechte
gerechter zwischen den Staaten aufteilt. Das eigentlich Entscheidende ist aber
nicht „gerechte Aufteilung“, sondern die richtige Entwicklung der
Wasserressourcen, damit der Wasserbedarf und die zukünftigen
Entwicklungsbedürfnisse aller Anliegerstaaten gedeckt werden.
Das Abkommen von 1959 kam zustande, nachdem Ägypten und der Sudan sich von
der Kolonialherrschaft des Britischen Empire befreit hatten, und folgte dem
Vorbild, das die Verwaltung des anglo-ägyptischen Sudan 1929 mit der ebenfalls
unter britischer Oberherrschaft stehenden Regierung des Königreichs Ägypten
geschlossen hatte. Darin war nicht nur festgelegt, daß Ägypten und der Sudan
48 Mrd. m3 bzw. 4 Mrd. m3 des Nilwassers
nutzen durften, Ägypten wurde auch das Recht vorbehalten, die Wasserführung
des Nil in den Staaten am Oberlauf zu beobachten und „gegen jedes Bauprojekt,
das seine Interessen beeinträchtigen würde, ein Veto einzulegen“.
1999 einigten sich alle Anlegerstaaten des Nil auf die Nilbecken-Initiative
(NBI),2 die einen partnerschaftlichen Mechanismus schaffen soll, um
den Strom in kooperativer Art und Weise zu entwickeln, substantiellen
wirtschaftlichen Nutzen zu teilen und regionalen Frieden und Sicherheit zu
fördern. Aber der Mangel an Entwicklung und die zahlreichen politischen
Konflikte in dieser Region behinderten diese Initiative.
2010 unterzeichneten auf Initiative Äthiopiens vier der acht Staaten des
Nilbeckens - Äthiopien, Ruanda, Tansania und Uganda - trotz hartnäckigen
Protestes Ägyptens und des Sudan einen neuen Vertrag über eine gerechtere
Aufteilung des Nilwassers. „Dieses Abkommen nützt uns allen und schadet keinem
von uns“, sagte Äthiopiens Minister für die Wasservorkommen, Asfaw Dingamo.
„Ich bin fest davon überzeugt, daß alle Länder des Nilbeckens das Abkommen
unterzeichnen werden.“ Burundi und die Demokratische Republik Kongo waren bei
den Treffen nicht vertreten, die kenianische Regierung übermittelte eine
Unterstützungserklärung.
Damit Afrika und speziell die Nationen des Nilbeckens die Hoffnung ihrer
Völker auf Frieden und Entwicklung erfüllen, die zu geringe Modernisierung
überwinden und die durch Armut, Mangel an Bildung und Kämpfe um „begrenzte
Ressourcen“ verursachten Kriege (die nur anglo-amerikanischen und anderen
fremden Interessen dienen) beenden können, muß sich die Beziehung der
menschlichen Gesellschaft zu der sie umgebenden Natur ändern. Die Zivilisation
darf nicht länger der Willkür der „Götter“ und den Kräften der Natur
ausgeliefert sein. Die Menschheit ist die einzige bekannte kreative Gattung im
Universum, und sie ist mit besonderen Fähigkeiten ausgestattet, mit denen sie
die Naturkräfte beherrschen und zu ihrem legitimen Vorteil nutzen kann.
Außerdem haben diese Nationen jetzt dank dem Entstehen einer neuen,
gerechten Weltwirtschaftsordnung unter dem gewachsenen Einfluß der
BRICS-Gruppe - Brasilien, Rußland, Indien, China und Südafrika - und der von
ihr gegründeten Neuen Entwicklungsbank (NDB) und dem damit eingeläuteten Ende
der Vorherrschaft der rassistischen Politik der Briten und anderer westlicher
Einflüsse eine wirkliche Chance, aus der Asche der jahrzehntelangen
Bürgerkriege und der Unterentwicklung aufzuerstehen.
Geometrische statt lineare Entwicklung
So wird beispielsweise in fast allen „akademischen“ Schriften und Berichten
internationaler Organisationen, darunter die Vereinten Nationen, das Nilwasser
als ein geschlossenes System mit einer begrenzten Wassermenge und einem
begrenzten Entwicklungspotential behandelt. Bei diesen linearen Berechnungen
der Wasser- und Landressourcen wird ignoriert, daß der Mensch mit
entsprechendem Wissen schöpferisch eingreifen und mit Hilfe der Technik diese
Ressourcen verändern und ihre Wirkung vervielfachen kann. Man sieht im
Gegenteil in den Menschen, deren Anzahl und Bedürfnisse geometrisch zunehmen,
eine Belastung der natürlichen Ressourcen, welche nach der menschenfeindlichen
Theorie von Thomas Malthus, dem Hauswissenschaftler des Britischen Empires,
höchstens arithmetisch zunehmen. Das spiegelte sich, meist unbewußt, in vielen
„wissenschaftlichen“ Papieren wider, die bei Konferenzen zur Wasserfrage, an
denen der Verfasser teilgenommen hat,3 vorgetragen wurden.
Die Bevölkerung der Nationen des Nilbeckens und Ostafrikas hat sich seit
den 1960er Jahren von rund 100 Mio. auf heute rund 400 Mio. Menschen
vervierfacht. Internationale Umwelt- und Finanzinstitutionen sehen darin eine
Katastrophe, aber ein denkender Mensch sollte es als eine große Quelle des
Wohlstands betrachten.
Die linearen „Fakten“ sind folgende, nimmt man die üblichen Angaben, etwa
von der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
(FAO):
Der Nil ist mit einer Länge von schätzungsweise 6852 km der längste Fluß
der Welt, er fließt von Süden nach Norden und quert auf diesem Weg 35
Breitengrade. Er speist sich aus zwei Flußsystemen: zum einen dem Weißen Nil,
dessen Quellen auf dem Plateau der äquatorialen Seen liegen (Burundi, Ruanda,
Tansania und Uganda, manchmal werden auch Kenia und die Demokratische Republik
Kongo hinzugerechnet), und zum anderen dem Blauen Nil, dessen Quellen im
äthiopischen Hochland und am Tanasee in 2100 m Höhe liegen.
Die Quellen des Weißen und des Blauen Nil liegen in Feuchtregionen, in
denen die Niederschläge zwischen 1200 und 2600 mm im Jahr schwanken, was im
Vergleich zu anderen Regionen der Welt ziemlich viel ist. Aber der jährliche
Durchschnitt für das gesamte Nilbecken liegt nur bei 650 mm/Jahr. Das liegt
daran, daß hier auch die Trockenregion miteingeschlossen ist, die im Sudan
(bis zur Abspaltung des Südsudan durch das Referendum von 2011 das der Fläche
nach größte Land Afrikas) beginnt und sich bis zur Mittelmeerküste Ägyptens
hinzieht.
Der Sudan läßt sich in drei Niederschlagsregionen einteilen: den extrem
feuchten Süden, wo die jährlichen Niederschläge zwischen 1200 und 1500 mm im
Jahr betragen, die fruchtbaren Lehmebenen, in denen jährlich zwischen 400 und
800 mm Regen fallen, und die Wüste im Norden des Sudan, wo jährlich im Schnitt
bloß 20 mm Niederschlag fallen. Weiter im Norden, in Ägypten, liegen die
Niederschläge sogar unter 20 mm - oder wie der ägyptische Priester in Platons
Timaios sagt: Das Wasser kommt von unten, aber niemals von oben.
Die Gesamtfläche des Einzugsbereichs des Nil beträgt 3,2 Mio.
km2, das entspricht 10,3% der gesamten Fläche Afrikas. Wie schon
erwähnt, fällt der größte Teil der Niederschläge in der Region der
äquatorialen Seen, im Südsudan sowie im äthiopischen Hochland. Die
Gesamtniederschläge über dem Einzugsgebiet werden auf 800-1000 Mrd.
m3 geschätzt. Davon gehen fast 70% durch Verdunstung wieder
verloren. Der Anteil von Sudan und Ägypten zusammen liegt unter 10%.
Was bei diesen „linearen“ Fakten neben der enormen Verdunstung ebenfalls
nicht berücksichtigt wird, ist die Tatsache, daß es bei den Regenfällen und
der Wasserführung des Blauen Nil und anderer Nebenflüsse wie dem Atbara - im
Gegensatz zur fast gleichmäßigen Wasserführung des Weißen Nil - zwischen der
Regenzeit (Juli-September) und der Trockenzeit (November-Juni) dramatische
Unterschiede gibt. Die steigende Wasserführung des Blauen Nil verursacht
gewöhnlich katastrophale Überschwemmungen im Sudan und eine zunehmende
Verschlammung der Staubecken hinter Staudämmen wie Roseires und Chaschm
Al-Girba. Die Wasserführung des Blauen Nil muß also dringend reguliert werden,
um die mit diesen starken Schwankungen verbundenen Risiken zu reduzieren und
das Wasser an sich und die Stromerzeugung daraus besser zu nutzen.
Außerdem würde der Bau von Staudämmen am Blauen Nil und am Atbara (auch
Schwarzer Nil genannt) die für Ägypten verfügbare Wassermenge letztendlich
sogar vergrößern, weil in dieser Region mit ihrem gemäßigten Klima nur 3% der
Wassermenge verdunsten, während es am Assuan-Stausee fast 16% sind. Anderseits
hätte Ägypten nicht mehr den Vorteil des zusätzlichen Wassers in den
Hochwasserjahren, das dann nicht mehr im Assuansee zurückgehalten würde,
sondern in den Reservoirs am Blauen Nil, d.h. dem derzeit im Bau befindlichen
Großen Äthiopischen Renaissance-Damm.
Der Mangel an Wasserinfrastruktur hat ironischerweise zur Folge, daß es in
dieser wasserreichen Region wegen der starken jahreszeitlichen Schwankungen
der Niederschläge immer wieder zu großer Wasserknappheit kommt. Es fehlt an
Möglichkeiten, Wasser in den Zeiten des Überflusses zurückzuhalten, um es in
Zeiten der Knappheit nutzen zu können. Die künstlich angelegten Wasservorräte
beliefen sich nach Angaben der Nilbecken-Initiative bis vor kurzem in
Äthiopien auf bloß 47 m3 pro Einwohner, in Kenia auf 114
m3 und in Tansania auf 142 m3 - im Vergleich zu 6150
m3 in Nordamerika oder 4100 m3 in Australien.
Auch hier ist also das eigentliche Problem nicht, wieviel „natürliche
Ressourcen“ verfügbar sind, sondern, wie die Gesellschaft diese Ressourcen
durch Anwendung von Wissenschaft und Technik optimal nutzen kann. Die
technischen Methoden sind nichts neues, sie existieren in der
industrialisierten Welt seit mehr als hundert Jahren, aber in Afrika hat man
sie nicht zugelassen. Sogenannte Umweltschutzorganisationen,
Nichtregierungsorganisationen sowie Finanzinstitutionen wie Weltbank und
Weltwährungsfonds wurden in den letzten Jahrzehnten dazu benutzt, solche
Entwicklungsmaßnahmen in Afrika systematisch zu verhindern - genauso wie es im
19. und 20. Jahrhundert die Kolonialmächte getan hatten.
Verluste durch Verdunstung
Eine weitere nichtlineare Betrachtungsweise, um die Verfügbarkeit von
Wasser für die flußabwärts gelegenen Nationen wie Ägypten und den Sudan zu
verbessern, ist die Möglichkeit, die Verdunstung von Wasser aus der Region der
äquatorialen Seen zu reduzieren, bevor es den Nordsudan erreicht. Die
Verdunstung und die Transpiration (Freisetzung von Wasserdampf durch
Pflanzen), beispielsweise am Victoriasee und am Albertsee
(Mobutu-Sese-Seko-See), sind zwar natürliche Mittel zur Aufrechterhaltung des
Wasserkreislaufs, doch die Verdunstung in den Sümpfen und Feuchtgebieten ist
eher als Verlust von Wasser und kultivierbarem Land zu betrachten.
Der Kagera fließt in den Victoriasee, aus dem dann das Nilwasser durch den
Kyogasee und Albertsee nordwärts zur ugandisch-südsudanischen Grenze strömt.
Bei der Stadt Bor im Südsudan ändert sich das Gefälle, und hier beginnt der
große Sumpf - der Sudd. Der Umfang des Sudd verändert sich stark, je nachdem,
wieviel Wasser ihm zugeführt wird. In der Zeit der großen Regenfälle von
1961-1964 erreichte der Sudd eine Fläche von 29.800 km2, das
entspricht fast der Größe Belgiens.
In anderen Jahren lag die Größe des Sudd im Schnitt bei 16.000
km2, was immer noch eine ganze Menge ist. Der Nil durchströmt den
Sudd in zahlreichen Armen. Charakteristisch für diesen Sumpf sind schwimmende
oder angeschwemmte „Inseln“ - in Arabisch „Sudd“ genannt - von
Marsch-Vegetation in unterschiedlichen Zersetzungszuständen; manche davon sind
bis zu 30 km lang. In diesen trüben Gewässern leben auch zahlreiche
Stechmücken und andere Parasiten, die Krankheiten wie die Malaria übertragen.
Es ist fast unmöglich, den Sudd mit einem Fahrzeug oder einem Boot zu
durchqueren.
Im Sudd geht ein großer Teil des Nilwassers durch Verdunstung verloren. Der
durchschnittliche Wasserverlust durch Verdunstung wird für die Zeit von 1905
bis 1980 auf 16,9 Mrd. m3 jährlich geschätzt. In manchen Jahren
können es bis zu 20 Mrd. m3 sein, das ist fast ein Drittel der
jährlichen Wasserführung des Nil in Assuan.
Ein weiteres Beispiel sind die Sümpfe in Uganda, einem Land mit zahlreichen
Seen und Feuchtgebieten, in dem die erneuerbaren Wasservorkommen auf 39 Mrd.
m3 im Jahr geschätzt werden. Aber der Zustrom in das Land (an den
Ripon-Wasserfällen und aus der Demokratischen Republik Kongo) ist fast genauso
groß wie der Abfluß in den Südsudan, was bedeutet, daß eine Menge Wasser
innerhalb des Landes durch die Verdunstung aus den Seen und Feuchtgebieten
verloren geht. Fast 10% der Landfläche Ugandas sind Feuchtgebiete.
Wie viele andere Länder Afrikas, die vom Britischen Empire formal in die
Unabhängigkeit entlassen wurden, hat Uganda, das 1962 unabhängig wurde,
mehrere große Programme zur Trockenlegung von Sümpfen gestartet, insbesondere
in den 70er Jahren. Aber ein blutiger Bürgerkrieg, der 1979 mit der Absetzung
Idi Amins endete, und ein späterer Aufstand der Nationalen
Widerstandsbewegung, der 1985 zum Sturz Milton Obotes führte, haben diese
Pläne zunichte gemacht.
1986 verbot die Regierung weitere große Drainage-Projekte und schuf das
Nationale Programm zur Erhaltung und Verwaltung der Feuchtgebiete. Es
unterwarf sich der britisch inspirierten und gesteuerten Ramsar-Konvention
über Feuchtgebiete von internationaler Bedeutung, die von den früheren
Kolonialmächten benutzt wird, um unter dem Deckmantel von Umweltschutz und
Artenvielfalt die Entwicklung der Wasserressourcen in Afrika zu blockieren. So
wurde der direkte britische Kolonialismus durch den „grünen Kolonialismus“
(und Völkermord) des IWF und der Weltbank abgelöst. Nur kleine Projekte wurden
zugelassen, und dem Land wurde nahegelegt, seine Wasser- und Landressourcen
für die Produktion von Exportwaren wie Kaffee zu nutzen.
Die Ramsar-Konvention besagt, daß jedes Land eine Liste bestimmter Gebiete
auf seinem Territorium - die Ramsar-Liste - zusammenstellen muß, die dann von
einem Sekretariat im Büro der Weltnaturschutzunion (IUCN) in Gland in der
Schweiz verwaltet wird. 1999 wurde ein „strategischer Rahmen“ ausgearbeitet,
„um ein internationales Netzwerk von Feuchtgebieten zu entwickeln und zu
erhalten, die für die Erhaltung der globalen Artenvielfalt und die Erhaltung
von Menschenleben durch die von ihnen erfüllten ökologischen und
hydrologischen Funktionen wichtig sind“.
Auch wesentliche Teile des Sudd stehen auf dieser Ramsar-Liste. Durch die
Fertigstellung des Jonglei-Kanals (s.u.) könnte man große Teile dieses
gewaltigen Marschgebiets, das durch den Weißen Nil entsteht, in fruchtbares
Ackerland verwandeln. Aber fast 5,7 Mio. ha dieses Sumpfgebiets sind als
„Ramsar-Gebiet“ ausgewiesen, welches für alle Ewigkeit unverändert bleiben
soll.
Auch große Teile des Tschadsee-Beckens sind in den Listen der IUCN und von
Prinz Philips World Wildlife Fund (WWF) als unantastbar ausgewiesen - obwohl
es für die ganze Welt sehr wichtig wäre, den Tschadsee durch die Umleitung von
Wasser aus dem Kongo wieder aufzufüllen, weil er immer mehr austrocknet. Als
Vorwand wird angeführt, daß es sich um ein Biosphären-Reservat handele, das
dazu diene, die Vögelbestände am Tschadsee vor Eingriffen durch den Menschen
zu schützen. 160 Nationen haben die Ramsar-Konvention unterzeichnet, und
weltweit sind 1896 Gebiete ausgewiesen, mit einer Gesamtfläche von 186 Mio.
ha, mehr als die fünffachen Fläche Deutschlands.
Aufgrund der Ramsar-Konvention führte Ugandas Regierung 1995 eine
„Nationale Politik zur Erhaltung und Verwaltung der Feuchtgebiete“ ein. Darin
heißt es: „7.1: Trockenlegung von Feuchtgebieten: Uganda hat erlebt, daß in
großem Umfang Feuchtgebiete zur Entwicklung menschlicher Aktivitäten
trockengelegt wurden. Die Wirkung dieser Trockenlegung ist in vielen Teilen
des Landes zu sehen.“
Die „Strategie“ zum Umgang mit dieser Frage ist nicht Entwicklung, sondern
das Gegenteil: „1. Es wird keine weitere Trockenlegung von Feuchtgebieten
geben, wenn nicht andere, wichtigere Erfordernisse im Umweltmanagement Vorrang
haben.“ In der Erläuterung dazu heißt es: „Die künstliche Entfernung oder
Fernhaltung von Wasser aus einem Feuchtgebiet mit welchen Mitteln auch immer
stellt eine Trockenlegung dar. Dies kann durch Pumpen, durch Ausheben von
Wasserkanälen und möglicherweise in Verbindung mit übermäßigem Wachstum von
Bäumen geschehen. Eine weitere Methode der Trockenlegung kann der Bau von
Dämmen an den Zuläufen sein. Solche Veränderungen sind zu vermeiden.“
Aber jetzt, da das transatlantische System des Britischen Empire im
Bankrott versinkt, wird das Leiden der Menschen unter den gnadenlosen
Naturkräften die Regierungen in Uganda und anderswo zwingen, mit Unterstützung
durch das System der BRICS-Staaten diese Politik zu ändern.
Karte: FAO
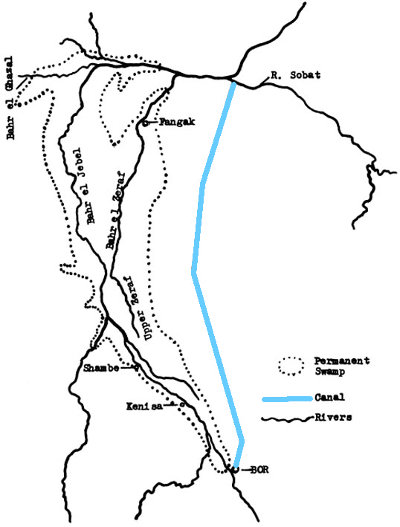
Abb. 2: Der Jonglei-Kanal soll einen Teil der Wasserführung des Nil um die
Sudd-Sümpfe herumleiten und dadurch einerseits Tausende Quadratkilometer Land
landwirtschaftlich nutzbar machen und andererseits mehrere Millionen
Kubikmeter Wasser vor der Verdunstung bewahren
Der Jonglei-Kanal
Eines der wichtigsten Drainageprojekte in Afrika ist der Bau des
Jonglei-Kanals, der den Zweck hat, einen Teil der Sudd-Sümpfe trockenzulegen
(Abbildung 2). Die Idee reicht noch in die britische Kolonialzeit
Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, die ersten ernsthaften Studien wurden 1946
von der ägyptischen Regierung durchgeführt, noch vor der endgültigen
Unabhängigkeit von den Briten.
Konkrete Pläne wurden dann aber erst unter der progressiven
republikanischen Regierung von Präsident Gamal Abdel Nasser 1954-59
ausgearbeitet. Eine Vereinbarung mit der Regierung des Sudan 1976 machte den
Weg frei für den Beginn der Bauarbeiten 1978. Doch eine von den Briten
inszenierte und von den USA unterstützte Rebellion brachte die Arbeiten 1984
zum Stillstand. Das erste große Ziel der Militäraktionen der Sudanesischen
Volksbefreiungsarmee (SPLA) unter John Garang war der aus Deutschland
stammende riesige Bagger „Sarah“, mit dem der Kanal ausgehoben wurde. Als die
Arbeiten eingestellt wurden, waren bereits 240 der 360 km des Kanals
fertiggestellt.
Dieser Kanal soll einen Teil des Wassers, das jetzt in den Sudd fließt,
vorher ablenken und direkt in Süd-Nord-Richtung von Bor nach Malakal leiten,
was sowohl der Region in der unmittelbaren Umgebung als auch den weit
flußabwärts gelegenen Regionen große ökologische und wirtschaftliche Vorteile
verschaffen würde.
Der Schaufelradbagger Sarah war ursprünglich in Pakistan im Einsatz
gewesen, wo er mit Erfolg die 101 km lange, 1970 fertiggestellte
Kanalverbindung zwischen Indus und Jhelam gegraben hatte. Er wurde dann
demontiert, in den Sudan geschafft und dort wieder zusammengebaut. Er ist der
größte Bagger der Welt mit einem Gewicht von 2100 Tonnen. 1981, als er im
vollen Einsatz war, grub er täglich eine Strecke von 2 km aus und bewegte
dabei 2500-3500 m3 Erde in der Stunde. Die gigantische Maschine
benötigt dabei pro Arbeitstag 40.000 Liter Treibstoff.
Mit dem Kanal sollen etwa 25 Mio. m3 Wasser täglich aus dem Nil
bei Bor unmittelbar oberhalb des Sudd entnommen und über seine 360 km lange
Strecke am Sudd vorbei nach Malakal geleitet werden - jährlich rund 4,7 Mrd.
m3. Dadurch würden (Verluste entlang des Verlaufs eingerechnet) dem
Unterlauf des Nil jährlich 3,8 Mrd. m3 mehr zugeleitet als bisher,
gemessen am Assuan-Damm. Durch die Entnahme der 25 Mio. m3 täglich
würde der Sudd um schätzungsweise 36% schrumpfen, von derzeit 16.900
km2 auf etwa 10.800 km2. Die Breite des Kanals beträgt
zwischen 28 und 50 Meter, seine Tiefe 4 bis 7 Meter.
Parallel zum Kanal sollten eine ganzjährig befahrbare Straße und weitere
ergänzende Projekte entstehen: Ablaufbahnen, Brücken, Fähren, Übergänge,
Bauten zur Regulierung der Wasserhöhe und andere Infrastruktur.
Als im Jahr 2000 im Sudan der Süd-Nord-Friedensprozeß in Gang kam, gab es
insbesondere in Ägypten Spekulationen und Vorstöße, den Bau des Kanals
fortzusetzen. Die Regierungen in Ägypten und im Sudan waren und sind sich
einig, das Projekt wieder aufzunehmen, aber den neuen Machthabern im Südsudan
war die „Unabhängigkeit“ und Abspaltung vom Norden wichtiger. Sie wurden von
den USA und Großbritannien unterstützt und dazu verleitet, eine
Konfrontationshaltung gegenüber der Zentralregierung in Khartum einzunehmen.
Den Politikern und der Bevölkerung im Südsudan wurde auch eingeredet, der
Jonglei-Kanal sei „imperialistisches“ Projekt Ägyptens, das den Menschen im
Südsudan keinen Nutzen brächte.
Als 2011 die Unabhängigkeit gewährt wurde, wurde der Südsudan von allen
früheren Unterstützern mit seinen massiven wirtschaftlichen und sozialen
Problemen im Stich gelassen. Deshalb kam es 2014 zu inneren Konflikten
zwischen rivalisierenden Stämmen und Milizen. Die Ölförderung des Südens, die
in den Friedensjahren zwischen 2000 und 2010 von der sudanesischen Regierung
aufgebaut worden war und die einzige Einkommensquelle des Landes bildet, wurde
wegen Grenzkonflikten mit dem Norden eingestellt. Der einzige Zugang zum
Weltmarkt für dieses Öl sind die existierenden Pipelines des Sudan nach
Khartum und Port Sudan am Roten Meer.
Die Regierung und politische Führung des Südsudan sind jetzt mit ihrem
neuen Staat hilflos gefangen, mit einer großen Hungerkrise, Bürgerkrieg, und
geographisch isoliert. Der einzige Ausweg aus dieser Lage ist, mit den
Nachbarn im Norden zusammenzuarbeiten und gleichzeitig neue Verbindungen für
Austausch und Handel mit den Nachbarn im Süden und Osten zu schaffen.
Letzteres hat erfreulicherweise inzwischen begonnen, dank der Kooperation
Chinas mit den Nationen Ostafrikas beim Bau von Verkehrskorridoren durch Kenia
in die landeingeschlossenen Nationen Südsudan, Äthiopien, Uganda, Ruanda,
Burundi und Demokratische Republik Kongo.4
Eine Entscheidung der südsudanesischen Regierung, in Zusammenarbeitet mit
Ägypten und dem Sudan den Bau des Jonglei-Kanals wiederaufzunehmen, wäre ein
sicheres Signal, daß der Südsudan bereit ist, sich an der kommenden
wirtschaftlichen und sozialen Renaissance Afrikas zu beteiligen.
Wasserkraft, Wasserregulierung und Entwicklung der Landwirtschaft
Derzeit sind mehrere sehr wichtige Staudammprojekte im Bau oder geplant,
die den Nilstaaten ein ganz neues Verhältnis zur Biosphäre bringen können. Der
Sudan hat kürzlich im Norden des Landes den Merowe-Damm fertig gestellt, ein
bedeutendes Projekt zur Stromerzeugung und Bewässerung.5 Außerdem
plant der Sudan noch weiter nördlich am 3. Katarakt den Kajbar-Damm. Am Atbara
und am Setit, zwei kleineren Zuflüssen des Nil, die im Norden Äthiopiens
entspringen, sind zwei weitere Staudämme im Bau. An fast allen diesen
Projekten sind chinesische Baufirmen und Finanzierung beteiligt.
Bild: http://grandmillenniumdam.net

Abb. 3: Bauarbeiten am Renaissance-Staudamm
Das größte Dammprojekt im Becken des Nil und in Afrika überhaupt ist jedoch
der Große Äthiopische Renaissance-Damm am Blauen Nil (Abbildung 3).
In den letzten Jahrzehnten war der Name Äthiopien oft mit Hunger, Armut und
Konflikten verbunden. Das wird sich nun ändern. Äthiopien mit seiner
Bevölkerung von mehr als 96 Millionen Menschen, einem historisch tief
verwurzelten Selbstbewußtsein der Bevölkerung und einem gewaltigen
Wirtschaftspotential war bisher nicht in der Lage, seine Potentiale zur
Entwicklung der Menschen, des Landes und seiner Ressourcen auszuschöpfen.
Dafür ist die Wasserkraft ein treffendes Beispiel.
Äthiopiens langfristiges Potential zur Stromerzeugung aus Wasserkraft liegt
bei 45.000 MW, davon werden aber bisher ganze 2000 MW genutzt! 2009 hatte
weniger als ein Zehntel der Äthiopier Anschluß an die Stromversorgung. Seit
2004 der Bau der „Gilgel Gibe“-Staustufen am Omo-Fluß begann, wird Äthiopiens
Stromerzeugung jedoch vervielfacht. Und wenn der Renaissancedamm 2018
fertiggestellt sein wird, wird er die Kapazität um weitere 6000 MW erweitern.
Die Gilgel-Gibe-Dämme wurden von China mit gebaut oder finanziert, während
westliche Umweltschutzorganisationen und Finanzinstitutionen die Projekte mit
einer großen Propagandakampagne und finanzieller Sabotage zu verhindern
suchten. Aber der Renaissancedamm beweist, welche Möglichkeiten die
Alternative des nationalen Kredits bietet, denn der Damm wird (abgesehen von
einer Sondersteuer) ausschließlich durch staatliche Anleihen finanziert, die
nur an äthiopische Staatsbürger im In- und Ausland verkauft werden. Die
gleiche Methode benutzt die neue ägyptische Regierung unter Präsident Abdel
Fattah Al-Sisi, um nationale Entwicklungsprojekte wie den Bau des Neuen
Suezkanals oder das Toschka-Projekt (vgl. Neue Solidarität 37, 38/2014)
zu finanzieren.
Der Bau des Renaissancedamms (kurz GERD) wurde 2011 vom damaligen
Premierminister Meles Zinawi gestartet. Der Auftrag für den Bau für über 4,3
Mrd.$ ging an den italienischen Baukonzern Salini Impregilo. Chinesische
Banken sollen den Bau des Wasserkraftwerks und seiner Komponenten finanzieren,
das sind weitere 1,8 Mrd.$. Äthiopien hat den Nachbarstaaten angeboten, sich
an der Finanzierung des Baus zu beteiligen und im Gegenzug dafür Strom zu
erhalten. Der bisher größte ausländische Käufer von GERD-Bonds ist Dschibuti.
Ägypten und der Sudan halten sich zurück, weil sie die politischen und
technischen Entscheidungen einer Kommission der drei Länder abwarten wollen,
die derzeit die Auswirkungen des Staudamms auf den Sudan und Ägypten
untersucht.
Die Gewichtsstaumauer wird 170 m hoch und 180 m lang werden und aus
verdichtetem Beton bestehen. Der Damm wird zwei Generatorhäuser haben, jeweils
eines auf beiden Seiten des Überlaufs. Diese beiden Kraftwerke werden jeweils
acht 350-MW-Francis-Turbinengeneratoren enthalten. Der Damm wird seitlich
ergänzt durch einen 50 m hohen und 5 km langen Satteldamm. Das Reservoir wird
ein Volumen von rund 63 Mrd. m3 haben - das entspricht der gesamten
Wassermenge, die innerhalb eines Jahres des Assuan-Damm passiert. Dies ist,
wie schon erwähnt, eine große Sorge Ägyptens, weil nach der Fertigstellung des
Damms die Wasserführung des Nil mehrere Jahre lang um 10-15% geringer sein
wird, bis das Staubecken gefüllt ist.
Vorteile und Einwände
Wie schon erwähnt, ist die Wasserführung des Blauen Nil großen
jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen, und der Damm würde dazu beitragen,
Überschwemmungen flußabwärts zu reduzieren - sowohl entlang der 40 km des
weiteren Flußlaufs in Äthiopien als auch im Sudan, wo es praktisch alljährlich
zu großen Überschwemmungen kommt.
Früher betrachtete man diese Überschwemmungen als nützlich für die
Landwirtschaft, weil der Fluß die Felder düngte und half, neue Flächen zu
bewässern. Aber mit der Einführung moderner Landwirtschafts- und
Bewässerungsmethoden müssen die alten Methoden weichen.
Auch wenn der Renaissancedamm nicht in einer dichtbesiedelten Region liegt,
wird er einen Teil der Infrastruktur für moderne agroindustrielle Zentren
bilden. Gleichzeitig wird der Damm eine Brücke über den Blauen Nil sein, und
mit den Straßen, Zementfabriken und Werkstätten, die für die Bauarbeiten
geschaffen wurden, wird diese Region zu einer der wirtschaftlich am
schnellsten wachsenden Regionen Afrikas.
Die Idee, Elektrizität über große Distanzen in andere Landesteile zu leiten
und Strom in den Sudan und nach Ägypten zu exportieren, bietet sich aus
monetaristischer Sicht natürlich an, um dem Land als Einkommensquelle zu
dienen. Langfristig aber wird man, wenn sich Äthiopien als agroindustrielles
Land angemessen entwickelt, fast diesen gesamten Strom und vielleicht noch
mehr im Inland benötigen. Für Ägypten und den Sudan ist die Nutzung von
Kernkraft und Kernfusion die richtige Alternative für die Zukunft.
Die Auswirkungen des Damms auf die stromabwärts gelegenen Länder sind
derzeit im einzelnen noch nicht klar, weil man noch zu keiner Einigung gelangt
ist. Ägypten befürchtet eine zeitweilige Reduzierung der verfügbaren
Wassermenge während der Auffüllung des Stausees, dessen Volumen fast der
gesamten durchschnittlichen Wasserführung des Nils (65,5 Mrd. m3)
an der ägyptisch-sudanesischen Grenze entspricht. Diese Verluste für die
stromabwärts gelegenen Länder würden sich vermutlich über mehrere Jahre
verteilen. Hinzu kommt eine dauerhafte Reduzierung der Wasserführung wegen der
Verdunstung aus dem Stausee.
Dem Vernehmen nach sollen während des Auffüllens des Reservoirs jährlich
zwischen 11 und 15 Mrd. m3 Wasser zurückgehalten werden. Es wird
auch befürchtet, daß dies sich negativ auf Ägyptens Stromerzeugung am
Assuandamm auswirken würde. Der Renaissancedamm würde auch den Wasserpegel des
Nasser-Stausees auf Dauer senken, wenn das Hochwasser statt dessen in
Äthiopien zurückgehalten wird. Der Vorteil wäre, daß die Verdunstung,
gegenwärtig rund 10 Mrd. m3 im Jahr, verringert wird, aber der
Nachteil wäre, daß die Kapazität des Assuandamms zur Stromerzeugung sänke.
Aus dem bis zu 200 m tiefen Stausee im äthiopischen Hochland würde weit
weniger Wasser verdunsten als aus den weiter flußabwärts gelegenen Stauseen
wie dem Nassersee in Ägypten, der 12% des Wassers durch Verdunstung verliert,
weil das Wasser dort bis zu zehn Monate lang zurückgehalten wird. Indem bei
Bedarf Wasser aus dem Stausee abgelassen wird, läßt sich Ägyptens Wasserzufuhr
um bis zu 5% erhöhen, und die des Sudan ebenso.
Außerdem wird der Renaissancedamm auch Schlick zurückhalten und dadurch die
Nutzungsdauer der Staudämme im Sudan - wie dem Roseires-, dem Sennar- und dem
Merowe-Damm - sowie des Assuandamms in Ägypten verlängern.
Die Beziehungen zu Ägypten
Während die sudanesische Regierung den Bau des Renaissance-Damms seit 2011
unterstützt, ist die Lage in Ägypten etwas anders. Unter der kurzen Herrschaft
der Muslim-Bruderschaft 2013 lief eine massive Propagandakampagne gegen das
Projekt, es wurde behauptet, der Damm würde den Nil austrocknen lassen und die
Existenz Ägyptens bedrohen. Die Spannungen unterbrachen die Verhandlungen und
gemeinsamen Studien, die ein gemeinsames Expertengremium der drei Länder
begonnen hatte.
Die jetzige ägyptische Führung unter Al-Sisi entwickelt nun einen neuen
Ansatz. Während eines Besuchs in Äthiopien am 4. September sprach Ägyptens
Außenminister Sameh Shoukry mit seinem äthiopischen Amtskollegen Tedros
Adhanom über Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, und
eines der wichtigsten Themen war die Wiederaufnahme der Arbeit dieser
trilateralen gemeinsamen Kommission von Experten aus Ägypten, dem Sudan und
Äthiopien zur Untersuchung des Projektes. Shoukry sagte, Ägypten betrachte die
Beziehungen zu Äthiopien als ein entscheidendes Element der Außenpolitik
seiner Regierung.
Ende September besuchte der ägyptische Bewässerungs- und Wasserminister
Hossam Al-Moghasi mit einer Delegation Khartum, um dort mit seinen Kollegen
aus Äthiopien und dem Sudan zusammenzutreffen und die Arbeit der Kommission
wiederaufzunehmen.
Al-Moghasi besuchte anschließend die Baustelle des Damms und berichtete in
ägyptischen Medien, er habe neue Dokumente, Karten und technische Studien
erhalten, die er zum weiteren Studium an ägyptische Experten weiterleiten
wolle, um sicherzustellen, daß der Damm keine negativen Wirkungen auf Ägypten
haben werde. Er forderte bei dieser Gelegenheit auch die ägyptischen Medien
auf, in den Berichten über das Projekt und seine Folgen für Ägypten auf
Gründlichkeit und Objektivität zu achten, um die friedlichen Beziehungen zu
Äthiopien nicht zu gefährden. Er betonte auch, der Renaissancedamm werde die
Wasserzufuhr nach Ägypten nicht beeinträchtigen, da der Hauptzweck des Damms
die Stromerzeugung sei, und nicht der, Wasser in andere Regionen zu leiten
oder es für die Landwirtschaft in Äthiopien zu nutzen.
Präsident Al-Sisi traf im Juni während des Gipfeltreffens der Afrikanischen
Union in Äquatorialguinea und dann erneut Ende September während der
UN-Vollversammlung in New York mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten
Hailemariam Delasegn zusammen. Al-Sisi will Äthiopien noch vor Ende des Jahres
besuchen.
Es wäre ein wichtiger Schritt in die beste Richtung, wenn diese beiden
afrikanischen Giganten zusammenarbeiten. Politische Differenzen und Intrigen
zwischen den Nationen des Kontinents behindern schon seit Jahrzehnten Afrikas
Entwicklung. Nur durch solide wissenschaftliche Studien und kreatives
wirtschaftliches Denken können diese Länder die Kolonialära endgültig hinter
sich lassen und in die Ära von Souveränität und Entwicklung eintreten.
Anmerkungen
1. http://www.zeno.org/Philosophie/M/Platon/Timaios
2. Die Nilbecken-Initiative ist eine politische Vereinbarung zwischen zehn
Nationen: Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi, Demokratische Republik Kongo,
Kenia, Äthiopien, Südsudan, Sudan und Ägypten. Das physische Becken oder
Einzugsgebiet des Nil erstreckt sich auch bis nach Eritrea, das aber kein
Mitgliedstaat der NBI ist. Die acht Staaten, die einen spürbaren Einfluß auf
die Wasserführung des Nil nehmen könnten, wenn sie die Wasserinfrastruktur auf
ihrem Territorium ausbauen würden, sind Tansania, Uganda, Ruanda, Burundi,
Äthiopien, Südsudan, Sudan und Ägypten.
3. Siehe Hussein Askary, „Zwei Welten auf der Weltwasserwoche: Entwicklung
oder Tod“, Neue Solidarität 39/2012.
4. Im nächsten Teil dieser Serie werden wir auf Verkehrsprojekte für Afrika
eingehen.
5. Siehe Hussein Askary, „Baut tausend Merowe-Dämme!“, Neue
Solidarität 11/2009.

