Den Krieg beenden durch den Aufbau des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße
- Teil 2 -
Von Dean Andromidas und Hussein Askary
Aktuelle Medienberichte aus Afrika beschäftigen sich vor allem mit dem
Ausbruch der Ebola-Seuche in Westafrika und den schrecklichen Verbrechen der
salafistischen Terrorgruppe Boko Haram in Nigeria - beides wahre Tragödien und
Resultate der kriminellen Politik, Afrika bewußt unterentwickelt zu halten.
Aber gleichzeitig kommt aus Ostafrika ein Funken der Hoffnung, daß die
verheerende Wirtschaftspolitik der letzten vier Jahrzehnte auf dem Kontinent
rückgängig gemacht werden kann. Die kürzlich wieder angepackten ägyptischen
Entwicklungsprogramme - wie der Neue Suezkanal, über den wir im ersten Teil
dieser Serie berichteten (siehe Neue Solidarität 37/2014), und das im
folgende beschriebene Toschka-Projekt - können in Verbindung mit dem Aufbau
einer neuen Weltwirtschaftsordnung durch die Neue Entwicklungsbank der
BRICS-Gruppe eine allgemeine Bewegung in ganz Afrika auslösen, entscheidende
Infrastrukturprojekte zu beginnen oder wieder aufzugreifen und
fertigzustellen
Dies betrifft zum Teil Projekte, die durch die anglo-amerikanischen
geopolitischen Machenschaften direkt sabotiert wurden, wie der Jonglei-Kanal
im Südsudan, andere, die durch die amerikanisch-europäische Finanzkriegführung
verzögert wurden, wie die Staudammprojekte in Äthiopien, und solche, die nie
begonnen wurden, wie das Transaqua-Projekt zur Wiederauffüllung des
austrocknenden Tschadsees und der Bau des Grand Inga-Wasserkraftwerks am
Kongo.
Die EU hat dafür gesorgt, daß kein Geld in das Transaqua-Projekt investiert
wurde, und die britischen und amerikanischen Regierungen zogen den Tschad
jahrelang in einen Stellvertreterkrieg gegen den Sudan in der Region Darfur
hinein. Der Völkermord in Ruanda und Burundi, der auch den Kongo erfaßte,
verhinderte die Entwicklung der Wasservorkommen in der Region der Großen Seen
und des Kongobeckens. Hunderte ähnliche Wasser-, Elektrizitäts- und
Verkehrsprojekte liegen seit den 1960er und 70er Jahren fertig geplant in der
Schublade und müssen nur aufgegriffen und umgesetzt werden, damit Afrika seine
langersehnte wirtschaftliche Wiedergeburt erleben kann.
Der richtige Moment, Afrika diese überfällige Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen, ist jetzt offensichtlich gekommen.
Ägypten erobert seine Wüste
Nur wenige Wochen nach der Ankündigung des Suezkanal-Projekts durch den
ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah Al-Sisi erklärte Premierminister Ibrahim
Mahlab am 30. August, daß auch das Toschka-Projekt als nationales
Entwicklungsprojekt wieder aufgenommen wird. 17 Jahre nach seinem Baubeginn
unter dem damaligen Präsidenten Hosni Mubarak und mehrere Jahre nach der
faktischen Baueinstellung durch andere Regierungen kann nun auch dieses
Projekt zur Rückgewinnung der Wüste - das größte seiner Art weltweit -
verwirklicht werden.
Das Projekt sieht vor, Wasser aus dem Nassersee (dem Stausee am Assuandamm)
in die Westliche Wüste umleiten, um dort bis zu 1 Million Feddan, das sind
400.000 Hektar Land, zu bewässern und neue Städte und agroindustrielle Zentren
zu bauen. Die Schlüsselkomponente des Projekts, nämlich die Hauptpumpstation -
die größte der Welt - wurde schon 2005 installiert, und es wurde ein 50 km
langer Kanal gebaut. Bis zur Einstellung des Projektes 2008 waren bereits 1
Mrd. $ in den Bau investiert worden.
Mahlab sagte bei einer Besichtigungsreise in der Toschka-Region, die
Regierung werde eine gründliche Studie durchführen, um das Projekt, das auch
den Bau eines großen Straßen- und Infrastrukturnetzes vorsieht, zu
aktualisieren. Ein so großes Projekt dürfe man nicht vernachlässigen, sagte
der Premierminister. Toschka könne sich damit in ein modernes städtisches
Gebiet entwickeln und es könne dazu beitragen, die gesamte Region
wiederzubeleben.
Karte: Dr. Farouk El-Baz
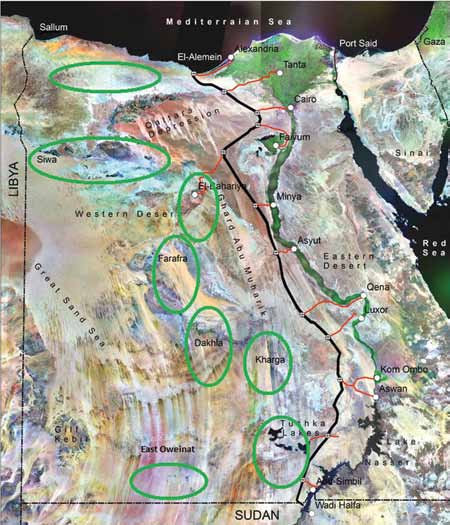
Abb. 1: Der von Dr. Farouk El-Baz vorgeschlagene Nord-Süd-Entwicklungskorridor
Karte: Wikimedia Commons
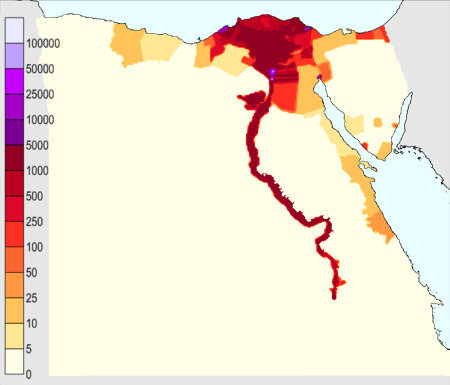
Abb. 2: Bevölkerungsdichte Ägyptens (Einwohner pro Quadratkilometer)
Bild: NASA/Landsat
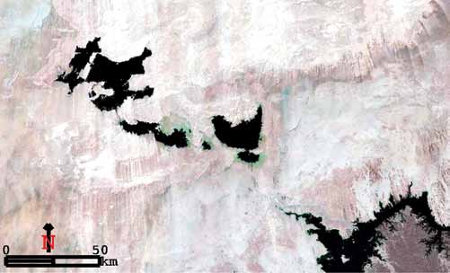
Abb. 3: Diese Satellitenaufnahme der NASA zeigt den Nassersee (im unteren
Teil des Bildes), den 50 km langen Sheikh-Zayed-Kanal und die bereits
entstandenen Toschka-Seen. Die eigentlich geplante Erschließung und
Urbarmachung großer Landflächen der Wüste für die landwirtschaftliche Nutzung
blieb bisher jedoch aus.
Das Toschka-Projekt und das Neue Tal
Das Toschka-Projekt ist der Eckstein des Großprojekts Neues Tal, das den
Ausbau und die Vernetzung einer Kette von Oasen über eine langgestreckte
Region umfaßt: von der Oase Ost-Oweinat mitten in der südwestlichen Wüste,
nahe der Grenze zum Sudan und Libyen, nach Nordosten bis Toschka und von dort
weiter nach Norden über die Oasen Al-Dachla, Al-Charja und Farafra in der
Provinz des Neuen Tals, sowie weiter nach Nordwesten über die Oase Bahriya bis
zur Oase Siwa im Nordwesten des Landes. Diese Kette von Oasen zieht sich
entlang des Projektes des „Nord-Süd-Entwicklungs-korridors“, den der
ägyptisch-amerikanische Wissenschaftler und frühere NASA-Ingenieur Dr. Farouk
El-Baz entworfen hat (Abbildung 1).1
Diese Oasen haben etwas wichtiges gemeinsam: Sie liegen allesamt über der
größten Grundwasserschicht der Welt, dem Nubischen Grundwassersystem (auch
Nubischer Sandstein-Aquifer genannt). Das gewaltige Vorkommen erstreckt sich
unter dem Tschad, Libyen, Ägypten und dem Sudan und enthält enorme
Wassermengen, die viele Jahrzehnte lang genutzt werden könnten. Nach
Einschätzung einiger Wissenschaftler, wie El-Baz und Dr. Robert Bisson, der
ein Modell zur Beurteilung von Grundwasser-vorkommen (das Megawassershed
Model) entwickelt hat, handelt es sich dabei nicht um fossile Vorkommen,
die per Definition begrenzt sind, sondern die Lager werden aus Niederschlägen
über Gebirgszügen in der afrikanischen Wüste regelmäßig aufgefüllt.
Darüber hinaus ist die Region reich an Mineralien und Metallerzen wie z.B.
Phosphat, Eisen und Kobalt, die zur Grundlage industrieller Aktivitäten
zusätzlich zur Landwirtschaft werden könnten.
Der von El-Baz vorgeschlagene Entwicklungskorridor umfaßt
1. eine Autobahn nach höchstem internationalen Standard von 1200 km Länge,
vom Westen Alexandrias bis zur Südgrenze Ägyptens;
2. zwölf Ost-West-Abzweigungen mit einer Gesamtlänge von etwa 800 km, die
diese Autobahn mit den Bevölkerungszentren entlang der Strecke verbinden;
3. eine Eisenbahn parallel zu der Autobahn für schnellen Transport;
4. eine Wasserpipeline vom Toschka-Kanal zur Versorgung mit
Trinkwasser;
5. eine Leitung für die Stromversorgung schon in den ersten
Entwicklungsphasen.
Das Toschka-Projekt würde in Kombination mit den anderen vorgeschlagenen
Projekten blühende neue Siedlungsgebiete für 16-20 Millionen Menschen
erschließen und Millionen Arbeitsplätze für das große Heer heute arbeitsloser
junger Ägypter schaffen. Ägypten wäre befreit von der Beschränkung auf das Tal
und Delta des Nils, wo 87 Millionen Menschen auf nur 5,3% der Landfläche
Ägyptens leben, während riesige Gebiete unbewohnt sind (Abbildung 2).
Dies machte Ägypten seit Ende der 1970er Jahre zunehmend anfällig für die
bevölkerungsfeindliche malthusianische Politik der Amerikaner und
Europäer.2
Toschka
Präsident Al-Sisis Entschlossenheit, Ägypten wissenschaftlich und
wirtschaftlich zu entwickeln, kommt auch darin zum Ausdruck, daß er am 7.
August durch ein Dekret einen speziellen Beirat von Wissenschaftlern und
Fachleuten für große Entwicklungsprojekte einrichtete. Wie sein Sprecher Ihab
Badawy in einer Presseerklärung mitteilte, ist der Beirat dem Präsidenten
persönlich unterstellt. Zu seinen Mitgliedern gehören der
Chemie-Nobelpreisträger Ahmed Zewail, der frühere NASA-Wissenschaftler und
Leiter des Zentrums für Fernerkundung der Universität Boston Farouk El-Baz und
eine Reihe weiterer prominenter und international gefeierter ägyptischer
Wissenschaftler. Während eines Treffens mit den Wissenschaftlern im
Ithadeya-Palast am 6. September sagte Al-Sisi, der Beirat werde die Qualität
des Bildungswesens verbessern und es an den Bedarf des Arbeitsmarktes anpassen
und außerdem Fragen der Geistlichkeit und der Medien beantworten.
Ein großer Teil des 1997 begonnenen Toschka-Projektes wurde im ersten
Jahrzehnt fertiggestellt, darunter die Pumpstation und der erste Abschnitt des
Sheikh-Zayed-Kanals , von dem bisher 50 km fertiggestellt sind (Abbildung
3). Der Kanal ist nach Scheich Zayed von den Vereinigten Arabischen
Emiraten benannt, der 60 Mio.$ für das Projekt spendete. Der Hauptkanal hat
den doppelten Querschnitt des Main-Donau-Kanals, er ist vollkommen mit
Spezialzement ausgekleidet und abgedichtet, und er dient dazu, Wasser von der
Pumpstation am Nassersee zu den vier Zweigkanälen zu bringen, um das
neuerschlossene Land zu bewässern. Vier Zweigkanäle wurden bisher noch nicht
gebaut, davon werden zwei vom Nassersee 120 km bzw. 100 km nach Westen und
Südwesten führen, die beiden anderen jeweils 120 km nach Norden und Nordosten.
Beiderseits dieser Kanäle sollte neues Land erschlossen und für die
landwirtschaftliche Nutzung vorbereitet werden. Dazu wurde ein umfangreiches
Straßennetz geschaffen, um Maschinen, Baumaterial und Menschen in die Region
zu transportieren.
Was falsch lief
Der Rest des Projektes wurde bis jetzt aufgehalten, weil Präsident Mubarak
sich der Vorgabe von Weltwährungsfonds und Weltbank unterwarf, Ägyptens
Landwirtschaft auf Nahrungsmittelexporte umzustellen, damit das Land seine
Schulden zahlen konnte. Dazu überließ er den Großteil der nutzbaren Landfläche
arabischen Fürsten und Unternehmern, die aber seit Jahren kaum etwas mit
diesem Land angefangen haben.
Der neue Kurs von Präsident Al-Sisi bedeutet einen dramatischen Bruch mit
dieser Politik Mubaraks, der die Aufbaupolitik aus der Ära von Präsident Gamal
Abdel Nasser (1956-1970) rückgängig gemacht hatte. So wurde beispielsweise
Nassers Landreform, die den Bauern eigenes Land gab, unter Mubarak aufgehoben.
In anderen Teilen Ägyptens schufen korrupte Politiker und Unternehmer große
Landgüter für exportierbare Nahrungsmittel. Von 1996 bis 2011 schossen die
Exporte von 350 Mio.$ auf 4 Mrd.$ in die Höhe. Die Folge war, daß Ägypten bei
weitem nicht genug für den Eigenbedarf erzeugte und deshalb der größte
Nahrungsmittelimporteur der Welt wurde. So wuchsen die Importe im selben
Zeitraum von 3 Mrd.$ auf 12 Mrd.$. Ein großer Teil des staatlichen
Haushaltsdefizits beruht darauf, daß die eingeführten Nahrungsmittel
subventioniert werden müssen, um sie für die armen Bevölkerungsschichten
erschwinglich zu machen.
Der Löwenanteil des Toschka-Landes ging an Saudis und reiche arabische
Scheichs. Die Firma KADCO des saudischen Unternehmers El-Waleed bin Talal bin
Abdul-Aziz, Mitglied des Königshauses und Leiter der riesigen Kingdom Holding
Company, ist einer von drei Konzernen, die jeweils 100.000 Feddan (40.000 ha)
Land zugewiesen bekamen, um es zu erschließen. Im April 2011 entzogen die
ägyptischen Behörden KADCO 75.000 Feddan wieder, weil der Konzern nur 17.000
Feddan erschlossen und ganze 3000 Feddan tatsächlich bepflanzt hatte.
Die Regierung Al-Sisi will nun den Investoren eine Frist von drei Jahren
setzen, um die ihnen zugewiesenen Landflächen in Toschka der
landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen, und sie verpflichten, konkrete
Zeitpläne für die Erschließung und Bepflanzung vorzulegen. Kabinettssprecher
Hossam Al-Kawish erklärte im August vor Journalisten, die Regierung werde dazu
einen neuen Gesetzesentwurf vorlegen. „Der Premierminister hat den
Landwirtschaftsminister beauftragt, ein Dokument zu erstellen, das die
Entwicklungsgesellschaften verpflichtet, die erforderlichen Arbeiten innerhalb
von drei Jahren abzuschließen. Wenn nicht, wird ihnen das Land entzogen und es
werden dann Gespräche mit den Landbesitzern in Toschka geführt.“
Das Landwirtschaftsministerium hat nun einen Plan, 50% des Landes an junge
Hochschulabsolventen zu verteilen, die jeweils fünf Feddan Land erhalten
sollen. Die Stiftung „Lang lebe Ägypten“, die im Juli von Präsident Al-Sisi
gegründet wurde, soll diese Landzuteilung an die Jugend finanzieren. Das
Projekt zielt nach der gegenwärtigen Planung darauf ab, in einer ersten Phase
108.000 Feddan (43.000 ha) zu erschließen. Das soll letztendlich bis auf 1
Mio. Feddan (400.000 ha) ausgeweitet werden, um die Selbstversorgung des
Landes mit Nahrungsmitteln zu erreichen. Bis 2014 wurden nur 55.000 Feddan
(22.000 ha) kultiviert. Die erste Phase soll innerhalb eines Jahres
abgeschlossen sein.
Bewässerungsminister Hossam Moghazy sagte: „Bei diesem Projekt geht es
nicht um Bewässerung und Landwirtschaft, sondern es ist ein
Entwicklungsprojekt, um aus dem engen Tal in die weite Wüste hinauszukommen,
die etwa 60% Ägyptens bedeckt.“ Der frühere Minister für Bewässerung und
Wasservorkommen Mahmoud Abu Zeid, der das Projekt 1997 mit initiiert hatte,
nannte die Fortsetzung des Toschka-Projekts „einen großen Schritt, denn wir
haben schon sehr viel Geld für die landwirtschaftliche Infrastruktur
ausgegeben. Die Ausweitung der Landwirtschaft ist der wichtigste Teil des
Projekts, und sie wird seit einiger Zeit aufgehalten, obwohl die Infrastruktur
dafür wie der Sheikh-Zayed-Kanal bereits vorbereitet ist.“
Der Experte Abbas Sharaky, Professor für Geologie und Wasservorkommen an
der Kairoer Universität, erklärte im Fernsehsender Al-Nahar, für die
Ausweitung der Landwirtschaft in Toschka brauche man anstelle der
traditionellen Bewässerungsmethode des Überflutens, die große Wassermengen
verbraucht, moderne Methoden wie Drehsprinkleranlagen und
Tröpfchenbewässerung.
Der Wirtschafts- und Landwirtschaftsexperte Sherif Fayad sagte, in der
Vergangenheit habe man sich nicht bemüht, Unterstützung in der Bevölkerung für
das Projekt zu gewinnen, und deshalb habe es auch keine „gesellschaftliche
Akzeptanz“ dafür gegeben. Die politischen Parteien und die bürgerliche
Gesellschaft hätten das Toschka-Projekt nicht unterstützt und gefördert, was
dazu beigetragen habe, daß das Interesse der Allgemeinheit wieder
eingeschlafen sei. „Das Land wurde unter Großinvestoren aufgeteilt, die es mit
der Ausweitung der Urbarmachung nicht ernst meinten. Außerdem bauten sie
Feldfrüchte mit geringen Erträgen an, die zuviel Wasser benötigten.“
Aber nun gibt es sichtliche Bemühungen, Unterstützung für das Projekt zu
gewinnen. Wie die ägyptische Zeitung Youm 7 berichtete, produzierte der
beliebte Fernsehmoderator Moataz Abdel Fattah eine Sendung über das Projekt,
als er im August Toschka besuchte. In der Sendung wurden Menschen vor Ort
interviewt, die daran erinnerten, daß tatsächlich lebensfähige Ortschaften mit
den entsprechenden Einrichtungen wie Schulen und Krankenhäusern aufgebaut
werden müssen.
„Wenn man eine Wohnsiedlung baut, wird es Siedler, die Arbeit suchen, dazu
anregen, hierher zu kommen, wenn sie alle Dienstleistungen finden, die sie
brauchen, wie Schulen, Häuser, Krankenhäuser und anderes“, erklärte einer der
Ansässigen, ein Herr Fayed. Um in Toschka wirkliche Gemeinden aufzubauen und
Siedler zu gewinnen, sollte der Staat Infrastruktur bereitstellen wie „Wasser,
Stromversorgung, Straßen, Flughäfen und Kanalisation“, sagte Fayed. „Der Staat
sollte an das wiederbelebte Projekt mit einer neuen wirtschaftlichen
Einstellung und Vision herangehen, um die hier in Toschka vorhandenen
Ressourcen am besten zu nutzen.“ Fayed fuhr fort: „Beim landwirtschaftlichen
Aspekt des Projektes sollte man auf den Anbau ertragreicher Feldfrüchte
setzen, die nicht viel Wasser verbrauchen“, etwa Palmen, Datteln und Trauben.
Der Staat müsse dazu entsprechende Gesetze einführen und Banken und
Kreditgenossenschaften bilden, die den jungen Leuten bei der Anschaffung von
Geräten, Düngemitteln und Schädlingsbekämpfungsmitteln helfen.
Landwirtschaftsminister Adel Al-Beltagy kündigte am 24. August an, die
Regierung strebe bis Ende 2017 bei Weizen einen Selbstversorgungsgrad von 75%
an. Dazu setze man auf verschiedene erprobte Methoden zur Steigerung der
Produktion und zur Reduzierung der Verluste.
Der Plan seines Ministeriums sei es, hochwertige Kleesorten (ein wichtiges
Viehfutter) zu erzeugen, um die Produktion insgesamt zu erhöhen und die für
den Klee notwendige Fläche zu reduzieren, damit mehr Fläche für Weizenanbau
frei wird.
Versorgungsminister Chalid Hanafy reiste im August in die USA, um Verträge
über drei Projekte für eine Verbesserung der Getreidelagerung und -verteilung
abzuschließen, wie die Zeitung Al-Ahram berichtete. Eines davon ist ein
182-Mio.$-Auftrag zur Modernisierung der 164 ägyptischen Getreidesilos durch
die Einführung moderner Lagertechniken, die Verluste verringern. Das zweite
ist ein Auftrag im Wert von 1,1 Mrd. Ägyptischen Pfund (LE, 154 Mio. $) zum
Bau von zehn Fabriken für Obst- und Gemüsekonserven. Hanafy sagte, das Projekt
werde die Kosten für die Konserven um 40% senken und die Versorgung der
Bevölkerung mit Obst und Gemüse verbessern.
Das dritte Vorhaben mit einem Umfang von rund 700 Mio. LE (100 Mio. $) ist
eine Spezialfabrik, die Lagertechnik und moderne Logistikanlagen für den
lokalen Markt und für den Export in afrikanische und arabische Länder
produzieren soll. Arabische Unternehmen werden in den kommenden 18 Monaten 15
Getreidesilos in elf Provinzen mit einem Gesamtwert von 300 Mio. $ errichten,
finanziert aus einem Zuschuß der Vereinigten Arabischen Emirate für den Bau
von insgesamt 25 Getreidesilos mit einer Gesamtkapazität von 1,5 Mio. t.
Weizen und andere Grundnahrungsmittel sind eine Frage des unmittelbaren
Sicherheitsinteresses der Nation, aber auf Dauer sollte Ägypten es vermeiden,
sich von Monokulturen abhängig zu machen. Wenn man in den neuerschlossenen
Gebieten verschiedene Arten von Bäumen, Feldfrüchten und anderen Pflanzen
anbaut, trägt das dazu bei, die Böden zu stabilisieren und zu verbessern, das
örtliche Klima wird milder und der Wasserverbrauch sinkt. Ägypten sollte nicht
denselben Fehler machen wie Saudi-Arabien in den 80er Jahren, als das
Königreich versuchte, Selbstversorgung bei Weizen und anderen Getreidearten zu
erreichen, indem es auf Monokulturen in großen Gebieten der Arabischen Wüste
setzte. Die Böden wurden mit der Zeit ausgelaugt und ihr Salzgehalt stieg an,
und nachdem man 300 Mrd. Kubikmeter Grundwasser verbraucht hatte (das
entspricht dem Sechsfachen der jährlichen Wasserführung des Nils), mußte das
Projekt aufgegeben werden, so daß nun wieder Wüste ist, wo zuvor Weizen
wuchs.
Herausforderungen und Chancen
Hier noch eine Zusammenfassung wichtiger Herausforderungen Ägyptens für die
nächsten Jahre:
Finanzierung: Eine große Frage ist, wie Ägypten die großen
nationalen Entwicklungsprogramme finanzieren wird, denn die westlichen
Finanzinstitute und Regierungen sind bei der Kreditvergabe mit dem Land schon
immer grausam umgesprungen. Für den Bau des Neuen Suezkanals ruft die
Regierung die Bevölkerung auf, das Projekt aus eigenen Mitteln durch den Kauf
von Schuldscheinen zu finanzieren, die nur Ägypter erwerben dürfen. Das ist
ein recht vernünftiger Ansatz. Aber bei der Finanzierung weiterer
Entwicklungsprojekte würde diese Methode schon bald an ihre Grenzen stoßen,
wenn jedes dieser Projekte als eigene Unternehmung behandelt würde. Deshalb
braucht Ägypten eine Hamiltonische Kreditschöpfung zur Schöpfung nationalen
Kredits.3 Die Neue Entwicklungsbank der BRICS-Nationen kann diesen
Kreditmechanismus unterstützen.
Elektrizität: Ein so umfangreiches Programm zur
agroindustriellen Entwicklung erfordert enorme Mengen an Strom und Wasser. Was
die Stromerzeugung angeht, verfügt Ägypten über begrenzte Öl- und
Gasvorkommen, die es noch erschließen und nutzen kann, aber das reicht bei
weitem nicht. Ohne eine Erneuerung des Kernkraftprogramms, das auf dem Papier
schon seit den 1960er Jahren besteht, aber niemals realisiert wurde, hat
Ägypten keine Chance auf eine wirkliche Entwicklung, ganz zu schweigen von
einem so massiven Aufbauprogramm, wie es hier beschrieben wurde.
Präsident Al-Sisis Regierung hat bereits erklärt, daß sie das erste
Kernkraftwerk des Landes in Al-Dabaa an der Mittelmeerküste bauen will.
Angesichts der allgemein negativen Haltung der USA und Westeuropas zu
Kernenergie und Technologie überhaupt sind die wahrscheinlichsten Kandidaten
für die Zusammenarbeit mit Ägypten hierbei Rußland, China und Südkorea.
Ägypten braucht Kernkraftwerke an den Küsten des Mittelmeers und des Roten
Meers, um Strom für die geplanten Industrien und Städte zu erzeugen.
Zusätzlich können die Küstengebiete sich selbst mit Trinkwasser versorgen,
indem sie die Prozeßwärme der Kernreaktoren für die Meerwasserentsalzung
nutzen.
Eine weitere, kurzfristiger verfügbare Energiequelle besteht durch das
Angebot Äthiopiens an Ägypten, Strom aus dem im Bau befindlichen
Grand-Renaissance-Stauwerk am Blauen Nil zu kaufen oder sich sogar an dem
Projekt zu beteiligen. Die letzten ägyptischen Regierungen hatten sich immer
geweigert, mit Äthiopien zusammenzuarbeiten, weil sie in dem Dammprojekt eine
Gefährdung der Wasserversorgung Ägyptens sahen.
Wasser: Ägypten ist in Bezug auf seine Wasserversorgung fast
vollkommen abhängig vom Nil, der sieben afrikanische Länder durchfließt, von
denen jedes eigene Bedürfnisse und Wünsche für die Entwicklung hat. Nach dem
Abkommen über die Nutzung des Nilwassers von 1959 zwischen Ägypten und dem
Sudan teilten beide Länder sich das Recht, das Wasser des Nils zu nutzen - der
Sudan 18,5 Mrd. m3, Ägypten 55,5 Mrd. m3. Das ist nun zu
einem Streitpunkt geworden, weil die anderen, südlich stromaufwärts gelegenen
Anliegerstaaten ein neues Abkommen schließen wollen, das ihnen mehr Rechte am
Nilwasser zubilligt.
1999 gründeten alle Anrainerstaaten gemeinsam die Nilbeckeninitiative
(NBI), die einen partnerschaftlichen Mechanismus schaffen soll, um den Fluß
gemeinsam zu bewirtschaften, den sozialen und wirtschaftlichen Nutzen zu
teilen und Frieden und Sicherheit in der Region zu fördern. Aber weil eine
gemeinsame Entwicklungsvision fehlte und weil anhand der unterschiedlichen
politischen, wirtschaftlichen und finanziellen Interessen der Länder Konflikte
künstlich geschürt oder sogar durch geopolitische und finanzielle Kriegführung
von außen aufgeheizt wurden, kam es zu keiner Einigung. So schlossen die
stromaufwärts gelegenen Staaten 2010 ein eigenes Abkommen, weshalb Ägypten und
der Sudan nun um weniger Nilwasser konkurrieren müssen.
Aber die Erneuerung der Entwicklungsprogramme in Ägypten kann zum Modell
für die übrigen Staaten des Nilbeckens und Ostafrikas werden, wovon auch
Ägypten wiederum in Bezug auf Wasserversorgung, Stromversorgung und Handel
profitieren würde. Dies wird das Thema des nächsten Teils dieser Serie
sein.
Anmerkungen
1. Eine Darstellung des von Dr. Farouk El-Baz vorgeschlagenen
Entwicklungskorridors finden Sie in dem Video „Unsere Hoffnung für Nordafrika:
Die blaue Revolution“, http://www.bueso.de/node/9711. Der Text dieses
Videos wurde in Neue Solidarität 13/2011 veröffentlicht
(http://www.solidaritaet.com/neuesol/2011abo/13/nordafrika.htm)
2. Siehe Hussein Askary, „Ägypten: Die Lüge von der ,Überbevölkerung’“,
Neue Solidarität 8/2011.
3. Eine Sammlung einschlägiger Aufsätze zu diesem Thema finden Sie im
Internetangebot der Neuen Solidarität unter der Rubrik „Kernthema:
produktive Kreditschöpfung“
(http://www.solidaritaet.com/neuesol/kredit.htm).

