Den Krieg beenden durch den Aufbau des Wirtschaftsgürtels der Seidenstraße
- Teil 1 -
Von Dean Andromidas und Hussein Askary
Unter der Führung von Präsident Abdel Fattah Al-Sisi hat sich Ägypten der
Bewegung für eine neue Weltwirtschaftsordnung angeschlossen, die im Juli von
den Staaten der BRICS-Gruppe bei ihrem Gipfeltreffen in Brasilien in Gang
gesetzt wurde. Inzwischen wurden bereits Großprojekte für den Bau des Neuen
Suezkanals (über den wir in diesem Teil unseres Reports berichten) und das
Toschka-Projekt zur Bewässerung einer halben Million Hektar Land und den Bau
neuer Städte für Millionen ägyptischer Bürger in der westlichen Wüste Ägyptens
gestartet (über das wir im zweiten Teil berichten werden).
Am 5. August leitete Präsident Al-Sisi die Zeremonie zur Eröffnung der
Bauarbeiten für den Neuen Suezkanal (siehe Neue Solidarität 35/2014).
Schon am nächsten Tag begannen 7500 Arbeiter unter der Aufsicht des
Pionierkorps der ägyptischen Armee, den Kanal zu graben. Das Ziel ist, die
Kapazität des Kanals mehr als zu verdoppeln. Seit seiner Nationalisierung
unter Präsident Gamal Abdel Nasser 1956 wurde der Querschnitt des Kanals
bereits um 400% vergrößert, sodaß heute fast alle Massengutfrachter und
Containerschiffe und etwa zwei Drittel der Öltankschiffe den Kanal passieren
können. Trotzdem entwickelt sich der Kanal zunehmend zu einem Engpaß im
weltweiten Schiffahrtsnetz.
Ägypten ist das bevölkerungsreichste Land in der arabischen Welt, und es
liegt sowohl an der „Maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts“ als auch am
„Wirtschaftsgürtel der Seidenstraße“, die der chinesische Präsident Xi Jinping
im vergangenen Oktober vorgeschlagen hat. Die Realisierung dieser Projekte
wird den Weg für eine Entwicklung in einem Maßstab ebnen, wie sie die Welt
noch nicht gesehen hat. Indem es sich den Bemühungen der BRICS-Staaten -
Brasilien, Rußland, Indien, China und Südafrika - anschließt, kann Ägypten
eine Schlüsselrolle spielen, wenn es darum geht, die Kriege und religiösen
Konflikte zu beenden, die von den um Großbritannien gruppierten imperialen
Kräften in ganz Südwestasien und Afrika in Gang gesetzt wurden.
Das Potential für ein afrikanisches Entwicklungsbündnis zeigt sich nicht
bloß in den jüngsten Entwicklungen in Ägypten und Südafrika. Auch in Ostafrika
hat Äthiopien viele seiner inneren politischen Konflikte gelöst und baut große
Staudämme für die Stromerzeugung und die Bewässerung, während es mit seinen
Nachbarstaaten über eine gemeinsame Nutzung des Nilwassers verhandelt. Im
Westen liegen Nigeria, das bevölkerungsreichste Land Afrikas und ein großer
Ölproduzent, das öl- und mineralreiche Angola sowie der schlafende Gigant, die
Demokratische Republik Kongo, deren Wasservorkommen allein einen großen Teil
des Kontinents aus seiner derzeit scheinbar unlösbaren Wasserknappheit
befreien könnte.
Kriege können nur gestoppt werden durch das Versprechen wirtschaftlicher
Entwicklung, die die Bevölkerung aus der Demoralisierung durch Bürgerkriege
und ethnische Streitigkeiten erheben kann. Das ist der Fall in Ägypten, dessen
innerer Konflikt seit 2011 Tausende von Menschenleben gekostet hat. Indem er
diese Megaprojekte startete, lenkt Präsident Al-Sisi die Aufmerksamkeit der
Bürger von den demoralisierenden Ereignissen der Vergangenheit auf den Aufbau
einer anständigen Zukunft für ihre Kinder.
Die beiden Megaprojekte
Der Bau des Neuen Suezkanals und des mit ihm verbundenen
Wirtschaftskorridors zielt darauf ab, die Kapazität des bestehenden Kanals zu
verdoppeln, den man zu Recht als die wichtigste Verbindung der weltweiten
Schiffahrt bezeichnen kann. Nach den ägyptischen Plänen soll die gesamte
76.000 km2 umfassende Kanalzone mit Industrie-, Logistik-,
Technologiezentren und Universitäten transformiert werden. Die Logistik- und
Industriezentren am Korridor des Suezkanals werden als Brücke nach Asien
dienen und gleichzeitig Zonen des Friedens und der wirtschaftlichen
Entwicklung schaffen, die von dort ausstrahlen wird in die jetzigen Zonen von
Krieg und Zerstörung - Israel und Palästina, Syrien und den Irak.
Das Toschka-Landwirtschaftsprojekt liegt in der westlichen Wüste Ägyptens,
dem östlichsten Teil der Sahara. Das Projekt wird Wasser aus dem Nasser-See,
der sich infolge der Aufstauung des Nil durch den Assuan-Staudamm bildete, in
die westliche Wüste leiten. Die Zusammenarbeit betrifft alle Anliegerstaaten
des weißen und des blauen Nil bis hinab zum schönen, aber falsch benannten
Victoriasee, der an Kenia, Uganda und Tansania angrenzt.
Der wichtigste Aspekt dieser Projekte ist, daß sie als Vorbilder dafür
dienen können, eine wirkliche, wirtschaftliche Entwicklung in Gang zu setzen,
statt auf das Anlocken ausländischer Investoren durch Steuerbegünstigungen und
Billiglöhne zu setzen („Cargo-Cult“), die dann exportorientierte Betriebe
aufbauen sollen, aber in Wirklichkeit nichts zur wirtschaftlichen Entwicklung
des Landes beitragen. Eine Politik, die den Ausbau der Infrastruktur
vorantreibt, entwickelt nicht nur die Nation, sie wird auch ausländische
Investitionen für produktive Zwecke anziehen, weil sie größere Chancen bieten
als die angeblichen Vorteile der billigen Arbeitskräfte und nicht nur dem
ausländischen Investor, sondern auch dem jeweiligen Land dienen.
Schon ihrer Natur nach haben diese beiden Projekte kontinentalen Charakter
und Wirkung. Für Afrika könnte Ägypten (in Zusammenarbeit mit den
BRICS-Nationen) eine Schlüsselrolle bei der Durchführung von
Entwicklungsprojekten übernehmen, die bisher aufgrund der kriminellen Politik
des transatlantischen Finanzempires entweder aufgehalten oder überhaupt nie
gestartet wurden. Dazu gehören u.a. das Jonglei-Kanalprojekt und die Schaffung
eines Korridors für die Entwicklung der Wasservorkommen, des Verkehrs und der
Stromerzeugung von der Region der Großen Seen im Osten Afrikas bis zum
Mittelmeer (etwa durch Aiman Rscheeds Africa-Pass-Projekt1 und
Äthiopiens Staudamm-Projekte. Andere Projekte können mit Unterstützung
Ägyptens und der BRICS-Gruppe realisiert werden, wie z.B. das
Transaqua-Projekt2 zur Wiederauffüllung des Tschadsees, die
Eisenbahnen von Port Sudan und Dschibuti nach Dakar und das Bahnprojekt
Kairo-Kapstadt. Die Entwicklung der vom Krieg zerstörten Provinz Darfur im
Sudan sowie des Südsudan wird ein integraler Bestandteil dieser Projekte
sein.
Karte: http://www.suezcanal.gov.eg

Abb. 1: Nach den Plänen der ägyptischen Regierung soll die Kapazität des
Suezkanals in den kommenden zwölf Monaten dramatisch erweitert werden
Die Großprojekte, die jetzt in Ägypten realisiert werden, bilden eine
wunderbare Ergänzung zu dem „Programm für ein Wirtschaftswunder in Südeuropa,
der Mittelmeerregion und Afrika“,3 in dem die Infrastrukturprojekte
identifiziert werden, die notwendig sind, um die Region auf beiden Seiten des
Mittelmeers in die Eurasische Landbrücke einzubinden.
Der Neue Suezkanal, Phase I
Das Projekt des Entwicklungskorridors des Neuen Suezkanals (Abbildung
1) wird Afrika und Eurasien in dreifacher Weise verbinden - einerseits
durch seine maritime Funktion, indem es die Meere und Ozeane Asiens mit dem
Mittelmeer und dem Atlantik verbindet; andererseits als Landkorridor mit
Eisenbahnen und Straßen, und drittens als industrieller und logistischer
Knotenpunkt der Entwicklung, von dem die Entwicklung nach Norden und Osten -
nach Palästina, vor allem in den Gazastreifen, nach Israel, Jordanien, in den
Libanon, nach Syrien, in den Irak - und nach Afrika ausstrahlt.
Der Suezkanal ist derzeit ein Engpaß für den Verkehr zwischen Asien und
Europa. Zehn Prozent des Welthandels, 18.000 Schiffe jährlich - im Schnitt 49
pro Tag -, passieren diese 163 km lange Wasserstraße, die meist nur 60 m breit
ist. Die Tatsache, daß der Kanal jeweils nur den Verkehr in einer Richtung
ermöglicht, macht es notwendig, daß die Schiffe ihn jeweils im Konvoi
befahren, was oft zu Verzögerungen von 30-40 Stunden führt. Der Neubau des
Kanals wird es ermöglichen, die Zahl der Schiffe, die ihn täglich passieren,
zu verdoppeln und die dafür nötige Fahrzeit von 18 auf 11 Stunden zu
reduzieren.
Der „neue Suezkanal“ bildet die erste Phase des Projektes und umfaßt das
Graben eines neuen, 35 km langen Kanals vom Mittelmeer parallel zum alten
Kanal bis zu den Bitterseen und die Verdoppelung des Kanalquerschnitts an der
37 km Strecke südlich der Seen. Dazu müssen mehr als 300 Mio. m3
Sand bewegt werden, die, wenn man sie in einer Reihe aufeinanderstapeln
könnte, bis zum Mond reichen würden. Bis Redaktionsschluß waren durch den
Einsatz von 15.000 Arbeitern und 52 Unternehmen bereits mehr als 20 Mio.
m3 entfernt worden.
Diese Phase des Projektes wird geschätzte 4 Mrd.$ kosten. Die Ägypter
werden aber nicht zulassen, daß es durch Auslandsanleihen oder frei
verkäufliche Aktien an den Börsen oder ausländische Interessen gekauft wird,
aus offensichtlichen Sicherheitsgründen. Die Ägypter erinnern sich noch sehr
gut daran, daß es dem Britischen Empire gelang, das Land zur Kolonie zu
machen, weil Ägypten im 19. Jahrhundert Auslandskredite aufnahm, um den Bau
des Kanals zu finanzieren.
Diesmal wird das Land den Bau vollkommen aus eigenen Mitteln finanzieren
und eine Idee von Alexander Hamilton übernehmen. Die ägyptische Regierung wird
Schuldscheine im Nennwert von 10, 100 und 1000 ägyptischen Pfund verkaufen,
die mit 12% verzinst werden - aber nur ägyptische Staatsbürger können diese
Schuldscheine kaufen. Auch im Ausland lebende Ägypter können in US-Dollar
ausgewiesene Schuldscheine kaufen, die mit 3,5% verzinst werden. So wird das
Projekt vom ganzen ägyptischen Volk finanziert und gebaut.
Viele westliche Schiffahrtsexperten zweifeln, ob es sinnvoll ist, ein so
teures Projekt in einer Zeit zu starten, in der der Welthandel stagniert. Aber
Ägypten arbeitet mit den BRICS-Staaten zusammen, die eine starke Ausweitung
des Handels erwarten, weil sie auf eine starke Ausweitung der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit untereinander und mit verbündeten Nationen setzen und nicht
darauf, billige Waren und Rohstoffe auf den kollabierenden Märkte Westeuropas
und Nordamerikas abzusetzen.
Diese neuen, expandierenden Märkte der BRICS-Länder werden gezielt
aufgebaut. So wird die zunehmende Industrialisierung Chinas und Asiens eine
Ausweitung der Nahrungsmittelimporte dieser Länder erfordern, insbesondere von
Getreide und Fleisch. Die Chinesen suchen schon jetzt solche Importe, u.a. aus
den Ländern Osteuropas. Rußland und die Ukraine waren historisch die Brotkörbe
der Welt, aber seit dem Kollaps der Sowjetunion wurden diese Kapazitäten viel
zu wenig genutzt. Diese Exporte werden über das Schwarze Meer, das Mittelmeer
und durch den Suezkanal erfolgen; Getreide wird dazu in sog.
„Suezmax“-Massengutfrachtern transportiert. Das zeigt die Bedeutung von Suez
als Knotenpunkt des globalen Güterverkehrs. Hier begegnen sich die
Schiffahrtsrouten und Landrouten. Im „multimodalen“ oder „kombinierten“
Verkehr konkurrieren diese verschiedenen Verkehrsarten nicht miteinander,
sondern sie ergänzen sich, um einen schnellen und effizienten Welthandel zu
ermöglichen.
Im heutigen Langstrecken-Schiffsverkehr dominieren die sog. „Superschiffe“,
Tanker, Massengutfrachter und Containerschiffe, die mit mehr als 150.000 BRT
deutlich größer sind als selbst die größten Flugzeugträger der US-Marine. Die
größten dieser Containerschiffe der Tripel-E-Klasse, die von der dänischen
Reederei Møller-Maesk betrieben werden, haben eine Verdrängung von 165.000 BRT
und können 18.000 20-Fuß-Container-Einheiten transportieren; der Wert der
Fracht liegt dabei im Schnitt bei einer halben Milliarde Dollar. Würde man
diese Container mit dem Zug transportieren, wäre dieser mehr als 100 km lang.
Diese Schiffe sind so groß, daß sie nur wenige Häfen anfahren können, und sie
passen nicht durch den Panamakanal oder den Bosporus.
Als Verkehrsknotenpunkt dient die Suezkanalzone natürlich auch als
Umschlagsplatz, und die dazu nötigen Einrichtungen werden deutlich ausgebaut,
darunter auch die verschiedenen Häfen in der Region. Schon jetzt liegt im
Osten von Port Said am Mittelmeer an der Zufahrt des Kanals der
Suezkanal-Container-Terminal von Port Said. Dieser moderne Terminal dient fast
ausschließlich dem Durchgangsverkehr. Er wurde 2004 eröffnet und seine
Kapazität in den letzten Jahren verdoppelt. Damit ist er nun der größte
Container-Terminal am Mittelmeer. Aber neben der Ausweitung der Kapazität des
Containerhafens werden auch andere Terminals ausgebaut, beispielsweise die
Terminals für Flüssiggüter (Erdöl), Trockengüter, Agrarprodukte, ein Terminal
für den Roll-on-Roll-off-LKW-Verkehr und ein Bunkerterminal.
Die modernen Superschiffe löschen oft 2000 Container oder mehr für die
Verladung auf kleinere Seeschiffe und Küstenschiffe, die die Häfen im
östlichen Mittelmeer anlaufen. Einer dieser kleineren Häfen wird auch der
Hafen von Gaza sein, der im Rahmen eines dauerhaften Friedensabkommens
eröffnet werden muß, um den neuen Staat Palästina mit der Maritimen
Seidenstraße zu verbinden. Andere Häfen, die von diesen kleineren Schiffen
angefahren werden können, sind die beiden israelischen Häfen Ashdod und Haifa,
Beirut im Libanon, Lattakia in Syrien, Mersin an der türkischen
Mittelmeerküste, Izmir an der der türkischen Ägäisküste sowie die Häfen am
Schwarzen Meer wie Odessa in der Ukraine und die russischen Schwarzmeerhäfen;
Rußland plant den Bau eines logistischen Zentrums für den Import von
Agrarprodukten aus Ägypten und anderen Nicht-EU-Staaten. Sie werden auch
Container laden, die für die europäischen Atlantikhäfen bestimmt sind.
Am Südende des Kanals liegt Port Suez, und 17 km weiter südlich an der
Westküste des Golfs von Suez der Hafen Adabiya. Beide gehören zu den
wichtigsten Industriezentren Ägyptens.
50 km südlich von Suez liegt Suchna, der gerade erst entstehende „Hafen des
21. Jahrhunderts“. Es ist der erste von Anfang an umfassend geplante Hafen,
ein Hafen der sog. „dritten Generation“, ausgerüstet mit den modernsten
Technologien für den Export und Import von Fracht aller Art, Massengüter,
Container eingeschlossen.
In der Stadt Ain Suchna besteht seit 2006 Ägyptens Sonderwirtschaftszone,
ein Gemeinschaftsprojekt mit den chinesischen Unternehmen Tianjin Investment
Holdings of China. Ihr Vorbild sind die Sonderwirtschaftszonen in China, in
denen exportorientierte Unternehmen angesiedelt wurden. China plant die
Schaffung von insgesamt fünf solchen Zonen in Afrika, in denen chinesische
Unternehmen Fabriken ansiedeln sollen. Die erste dieser Zonen ist Ain
Suchna.
Es werden Eisenbahnverbindungen von diesen Häfen im Süden zu denen im
Norden entstehen, damit Schiffe ihre Güter, die für den Umschlag bestimmt
sind, löschen können, ohne den Kanal durchfahren zu müssen. Neben den
Tanklagern für flüssige Fracht müssen auch die Getreidelager, Lagerhallen etc.
ausgebaut werden. Auch die Werftanlagen müssen erweitert werden, um die
Reparatur von Superschiffen zu ermöglichen, damit die Region wirklich zu einem
globalen Verkehrsknotenpunkt entwickelt werden kann.
Suez, ein interkontinentaler Eisenbahn-Knotenpunkt
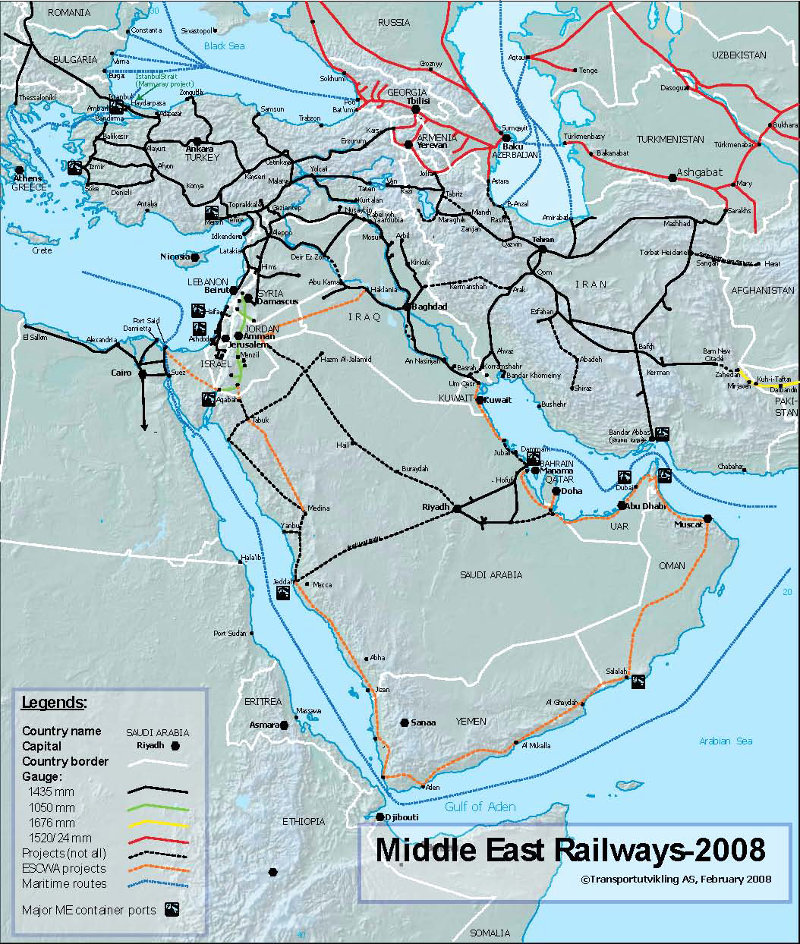
X
Abb. 2: Geplantes Eisenbahnnetz in den Maschrik-Staaten

X
Abb. 3: Geplant und streckenweise im Bau ist die Trans-Maghreb-Bahn von
Ägypten entlang der Nordküste Afrikas nach Marokko
Ägypten plant den Bau von sechs neuen Tunneln unter dem erweiterten Kanal,
um eine schnelle Entwicklung der bisher fast vollkommen unentwickelten Gebiete
auf der Sinai-Halbinsel östlich des Kanals zu ermöglichen. Mindestens zwei
dieser Tunnel werden Eisenbahntunnel sein, die Eurasien mit Afrika verbinden.
Fast alle Nationen westlich und östlich dieser Grenzlinie haben in den letzten
zehn Jahren Eisenbahnprojekte begonnen, mit chinesischer, russischer oder
europäischer Beteiligung. Aber die meisten dieser Projekte wurden aufgrund der
laufenden Kriege und Konflikte in Südwestasien und Afrika bisher nicht
fertiggestellt.
Im Osten des Kanals ist das Eisenbahnnetz des arabischen Maschrik (die
arabischen Staaten östlich von Libyen und nördlich von Saudi-Arabien) geplant
(Abbildung 2), ein fast 20.000 km und 16 Routen umfassendes Netz von
Hochgeschwindigkeitsstrecken in Südwestasien, westlich des Kanals die
Trans-Maghreb-Bahn.
Ägypten hat Pläne, sein Eisenbahnnetz bis zur Grenze des Gazastreifens
auszubauen, von wo eine Bahnverbindung über Gaza City weiter nach Norden in
die israelischen Küstenstädte führen könnte, darunter Tel Aviv und die Häfen
Ashdod und Haifa, und von dort weiter über Beirut und die übrigen Küstenstädte
des Libanon und Syriens - derzeit ein Kriegsgebiet - bis in die Türkei, wo
bereits verschiedene Abschnitte des Schnellstreckennetzes in Betrieb sind. Um
den Anschluß nach Europa und Eurasien herzustellen, müßte ein weiterer Tunnel
unter dem Bosporus gebaut werden, da der gerade fertiggestellte dortige
Bahntunnel Teil des S-Bahnnetzes von Istanbul ist.
Eine weitere Linie würde zu den Zwillings-Hafenstädten Eilat (Israel) und
Aqaba (Jordanien) am Roten Meer führen. Von Aqaba aus soll eine Bahnverbindung
nach Norden entstehen und Anschluß an die Eisenbahnnetze von Syrien und Irak
erhalten. Dadurch würde die Rolle Jordaniens als Durchgangsland gestärkt und
Aqaba zum Umschlagsplatz für Südwestasiens Warenverkehr von und nach Asien und
Ostafrika.
Im April 2014 empfing Jordaniens Premierminister Abdullah Ensour eine
Delegation des außenpolitischen Ausschusses der Chinesischen Politischen
Konsultationskonferenz und lud China ein, sich an diesem Eisenbahnprojekt zu
beteiligen, das Jordanien, wie er sagte, in die neue „Seidenstraße“
integrieren würde, die China mit der Levante verbindet.
Durch die Tunnel entsteht auch die Verbindung zu den Eisenbahnlinien nach
Westen, entlang der nordafrikanischen Küste (Abbildung 3). Ägypten hat
das älteste Eisenbahnsystem Afrikas und des Nahen Ostens. Es hat ein relativ
dichtes Netz von Eisenbahnstrecken in Kairo und der Delta-Region, sowie
Eisenbahnen entlang der gesamten Strecke des Nils in Ägypten und entlang der
Nordküste Ägyptens bis zur Grenze zu Libyen. Im vergangenen März kündigte
Ägyptens Verkehrsministerium an, daß es den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn
entlang des Niltals, die Alexandria mit Assuan an der Grenze zum Sudan und
damit die fünf wichtigsten Provinzen miteinander verbinden soll, zur Priorität
erhoben hat.
Diese Linie könnte nach Süden durch den Südan und Äthiopien bis Uganda,
Kenia etc. verlängert werden.
Wie am Projekt des Neuen Suezkanals ist das Pionierkorps der ägyptischen
Armee unmittelbar an der Planung und am Bau der Eisenbahnlinien beteiligt. Es
wird ebenfalls im Inland finanziert, durch den Verkauf von Anteilen und
Schuldscheinen, durch Kredite ägyptischer Banken sowie durch Investitionen
ägyptischer Unternehmer.
Schon jetzt besteht eine Verbindung von Ismailia am Suezkanal, wo einer der
neuen Tunnel unter dem Kanal entstehen wird, entlang der Mittelmeerküste zur
libyschen Grenze. Im Programm des Schiller-Instituts für den Mittelmeerraum
ist vorgesehen, diese Linie als Hochgeschwindigkeitsstrecke auszubauen und
durch Libyen, Tunesien, Algerien bis Marokko zu verlängern, und sie durch
Tunnel von Tunesien aus mit Italien und von Marokko aus mit Spanien zu
verbinden.
Der Sturz und die Ermordung des libyschen Präsidenten Muammar Gaddafi hat
dem Eisenbahnprojekt entlang der libyschen Küste, an dem sich Rußland und
China mit mehr als 1 Mrd. $ beteiligen, vorläufig ein Ende gesetzt. Es sollte
die erste Eisenbahnlinie des Landes werden und das Land mit Ägypten im Osten
und Tunesien im Westen verbinden. Auch wenn die russischen und chinesischen
Eisenbahningenieure das Land inzwischen verlassen haben, hat die libysche
Regierung erklärt, sie wolle die Arbeiten so bald wie möglich wieder in Gang
bringen.
Auch in Tunesien steht der Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahn auf der
Tagesordnung. Im Februar 2012 veranstaltete das tunesische Verkehrsministerium
eine Konferenz mit Vertretern der nationalen Eisenbahngesellschaften von
Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko und Mauretanien, um über den Bau der
Trans-Maghreb-Bahn zu diskutieren. Alle diese Länder sind sehr daran
interessiert diese Linie zu verwirklichen. Tunesien hat bereits angekündigt,
daß es in den kommenden zehn Jahren 5,5 Mrd. $ investieren wird, um die
Hochgeschwindigkeitsbahn als Verbindung zu den Nachbarstaaten zu realisieren.
Auch Algerien, wo bereits ein Eisenbahnnetz besteht, verfolgt ähnliche Pläne.
Marokko hat seine Hochgeschwindigkeitsbahn von Casablanca an der
Atlantikküste nach Tangier an der Mittelmeerküste bereits zur Hälfte
fertiggestellt und setzt dabei auf die Technologie des französischen TGV.
Außerdem haben Marokko und Spanien auch schon sehr ernsthafte Untersuchungen
und eine Machbarkeitsstudie für den Bau eines Eisenbahntunnels unter der
Straße von Gibraltar fertiggestellt. Wenn dieser gebaut wird, wäre es das
wichtigste transkontinentale Infrastrukturprojekt seit dem Bau des
Suezkanals.
Karte: Aiman Rscheed
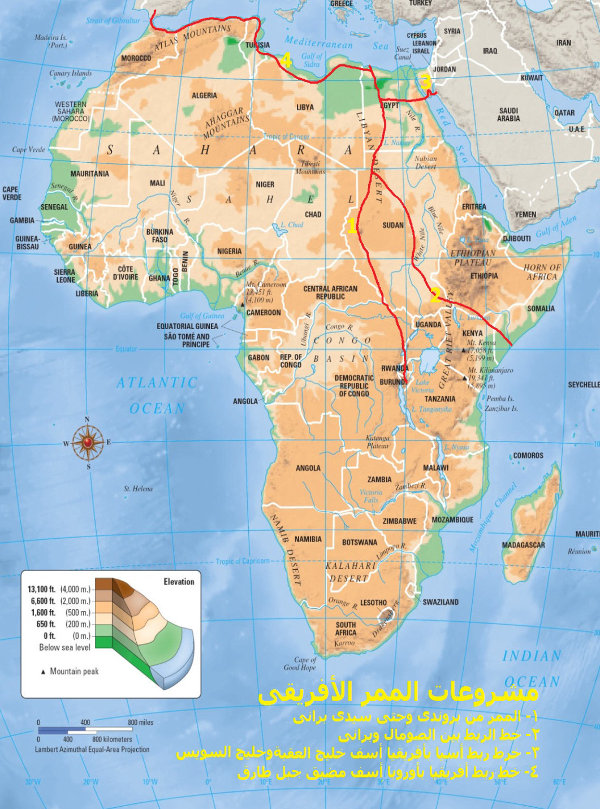
Abb. 4: Das Africa-Pass-Projekt würde Ostafrika an das eurasische
Eisenbahnnetz anschließen
Der Plan des Schiller-Instituts unterstützt auch einen Vorschlag des
ägyptischen Ingenieurs Aiman Rscheed, einen großen Hafen bei der ägyptischen
Stadt Sidi Barrani zu bauen, der als Endpunkt einer Eisenbahnstrecke dienen
soll, die von dort durch Westägypten in den Sudan führen und sich dort
verzweigen würde. Der eine Ast der Bahnstrecke würde weiter nach Süden bis in
die landeingeschlossenen Länder Rwanda, Burundi und Uganda führen, der andere
nach Südosten durch Äthiopien und Nordkenia bis Kismayu an der somalischen
Küste des Indischen Ozeans (Abbildung 4). Nach ihrer Fertigstellung
würden diese Bahnlinien fast ein Drittel Afrikas für eine schnelle weitere
Entwicklung erschließen.
Afrika auf dem Weg in die Kernfusionswirtschaft
Aber alle diese Projekte lösen noch nicht die größte Herausforderung, vor
der Ägypten, Afrika und Südwestasien stehen: die Stromerzeugung muß massiv
ausgeweitet werden, nicht bloß für die industrielle Entwicklung, sondern auch
für die Meerwasserentsalzung. Diese Steigerung der Stromerzeugung kann nur
durch den Einsatz von Kernkraft - Kernspaltung und Kernfusion - erreicht
werden. Alle Länder Nordafrikas leiden unter Wassermangel. Überall im Norden
Afrikas gibt es große Städte, aber es gibt bisher kein einziges Kernkraftwerk,
das billigen Strom für die Meerwasserentsalzung liefern könnte. Die große
Stadt Alexandria hat nicht einmal eine konventionelle Entsalzungsanlage.
Fast alle arabischen Nationen vom Persischen Golf bis zur Atlantikküste
planen daher den Bau von Kernkraftwerken. Die Vereinigten Arabischen Emirate
haben bereits mit dem Bau des ersten von insgesamt vier Kernreaktoren mit
einer Gesamtleistung von 5600 MW begonnen. Saudi-Arabiens Pläne
sind bereits weit fortgeschritten, und Jordanien hat eine Vereinbarung mit
Rußlands Atomkonzern Rosatom geschlossen, den ersten von zwei geplanten
1000-MW-Reaktoren zu bauen.
Nach der Übernahme des Präsidentenamtes bezeichnete Ägyptens Präsident
Al-Sisi den Bau des ersten ägyptischen Kernkraftwerks als eine der höchsten
Prioritäten seiner Regierung, und bei seinem Treffen mit Rußlands Präsidenten
Putin sprachen beide über die Zusammenarbeit im Bereich der Kernenergie.
Tatsächlich leidet Ägypten unter sporadischen Stromausfällen, weil derzeit
einfach zu wenig Elektrizität erzeugt wird.
Eine offizielle Ausschreibung für den Bau des Kernreaktors sollte noch vor
Jahresende erfolgen. Standort des Reaktors soll El-Dabaa an der
Mittelmeerküste sein, wo schon seit den 1980er Jahren Flächen dafür reserviert
sind. Die Regierung hat das Pionierkorps der Armee bereits beauftragt, die am
Standort bereits bestehenden Anlagen - Verwaltungsgebäude, Lager, Werkstätten,
Wasser- und Stromversorgung - instandzusetzen.
Ägypten hat relativ weit entwickelte Einrichtungen für die Kernforschung,
die der Ägyptischen Atomenergie-Behörde unterstellt sind, darunter zwei
Forschungsreaktoren: ein 1961 in Betrieb genommener 2-MW-Mehrzweckreaktor, und
ein 22-MW-Reaktor, der vom argentinischen Unternehmen INVAP gebaut und 1998 in
Betrieb genommen wurde. Es besteht auch eine Pilotanlage für die Herstellung
von Brennelementen für diese beiden Reaktoren, ein Strahlungslabor und ein
Zentrum für den Umgang mit Atommüll. In diesen Einrichtungen arbeiten fast
1000 Wissenschaftler und Ingenieure.
2011 gründeten der ägyptische Baukonzern Orascom und der staatliche
Baukonzern Arab Contractors ein Gemeinschaftsunternehmen, das
Kernkraftwerksprojekte in Ägypten und im Nahen Osten durchführen soll, bisher
aber noch keine Aufträge erhalten hat.
Ein Nuplex am Suezkanal
Damit kommen wir zur Phase III des Entwicklungskorridors am Suezkanal, der
Umwandlung der Kanalzone und der Sinairegion in ein Weltklasse-Zentrum für
Industrie und wissenschaftliche und technologische Forschung und Entwicklung.
Bei Ismailia - etwa in der Mitte des Suezkanals gelegen - sollen ein
„Technologie-Tal“ und einer der Standorte der Suezkanal-Universität
entstehen.
Karte: EIR
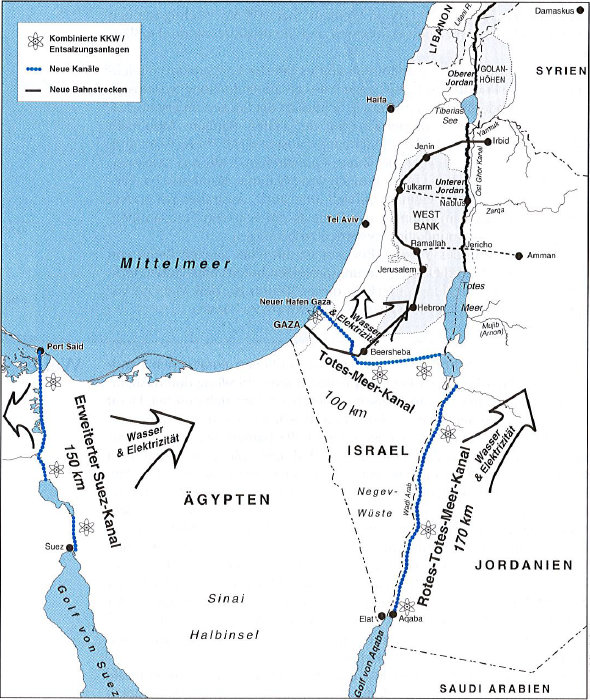
Abb. 5: In seinem „Oasenplan“ für den Nahen Osten griff Lyndon LaRouche
Anfang der 1990er Jahre Präsident Eisenhowers Vorschlag auf, durch den Bau
einer Reihe von Kernkraftwerken für die Erzeugung von Elektrizität und
Trinkwasser eine Grundlage für einen umfassenden Friedensprozeß für den Nahen
Osten zu schaffen.
Die bisher vollkommen unterentwickelte Sinai-Halbinsel und ihre Umgebung
sind reich an natürlichen Rohstoffen, die große Industriebetriebe versorgen
können - etwa Sand für die Glasherstellung. In der Region gibt es auch große
Salz-, Kali-, Kalk-, Granit- und Dolomitvorkommen.
Um sie zu nutzen, braucht man Strom - und zwar eine ganze Menge, den
Ägypten derzeit nicht hat. Auch das Kernkraftwerk bei El-Dabaa würde nach
seiner Fertigstellung noch nicht genug Strom für das Wirtschaftswunder
liefern, auf das Ägypten hinarbeitet. Ägypten braucht allein an seiner
Nordküste mehrere Kernkraftwerke, um große Bevölkerungszentren wie Alexandria
mit Strom und entsalztem Wasser zu versorgen und so den Druck auf den bereits
überlasteten Nil zu reduzieren.
Warum sollte man in diesem Umfeld des „Technologietals“ nicht auch gleich
einen „Nuplex“ - einen nuklearen, agroindustriellen Komplex - schaffen, indem
man inmitten der Kanalzone ein großes Kernkraftwerk aufbaut - vielleicht am
großen Bittersee -, das billigen Strom für die Entsalzung von Meerwasser und
für die Industrien in der Region liefert?
In den 1960er Jahren schlug der ehemalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower
vor, durch den Bau einer Reihe von Kernkraftwerken für die Erzeugung von
Elektrizität und Trinkwasser, u.a. an der Nordküste des Sinai, eine Grundlage
für einen umfassenden Friedensprozeß für den Nahen Osten zu schaffen
(Abbildung 5). Diese Vorschläge wurden aus politischen Gründen
sabotiert, weil die Vereinigten Staaten damals auf eine kernkraftfeindliche
Politik einschwenkten.
Mit reichlichem und billigem Strom wird es möglich, in der Region
Industrien aufzubauen, die nicht auf „billigen Arbeitskräften“ beruhen.
Billige Arbeitskräfte haben noch niemals zu einer wirklichen industriellen
Entwicklung geführt, entscheidend war immer die Verfügbarkeit von Energie
sowie von qualifizierten und motivierten Arbeitskräften.
In diesem Nuplex könnten großartige Bildungs- und Forschungseinrichtungen
geschaffen werden - nicht zuletzt für die Kernfusionsforschung -, die
Wissenschaftler aus der gesamten Region anziehen würden.
Unter den BRICS-Staaten und ihren Verbündeten gibt es etliche Partner für
ein solches Projekt, wie z.B. Rußland, China und Südkorea, die alle eine
eigene Nuklearindustrie und ehrgeizige nukleare Forschungsprogramme haben.
Andere Nationen im Umfeld der BRICS, die ebenfalls Nuklearprogramme
entwickeln, sind Indien, Argentinien und Brasilien.
Im zweiten Teil dieses Aufsatzes werden wir über das Toschka-Projekt und
die Begrünung der afrikanischen Wüsten berichten.
Anmerkungen
1. Siehe „Africa Pass: Ein revolutionäres Projekt für Afrika und den
Mittelmeerraum“, Neue Solidarität 26/2012,
http://www.solidaritaet.com/neuesol/2012/26/africa-pass.htm
2. Siehe „Das Transaqua-Projekt: Beginn einer Wiedergeburt Afrikas“,
Neue Solidarität 26/2012,
http://www.solidaritaet.com/neuesol/2012/26/transaqua.htm
3. Siehe http://www.bueso.de/wirtschaftswunder

