Das Transaqua-Projekt
Transaqua ist ein integriertes Projekt für Wasserversorgung,
Wasserkraftnutzung, Transport und Entwicklung der Agrarindustrie im Herzen
Afrikas. Experten beschreiben es als potentiellen Motor eines
Wirtschaftsaufschwungs für den gesamten Kontinent.
Die Idee für Transaqua ist Jahrzehnte alt, sie stammt von einem Team des
italienischen Ingenieurbüros Bonifica, damals ein Teil der staatlichen Holding
Istituto per la Ricostruzione Industriale (Institut für industriellen
Wiederaufbau, IRI). Transaqua soll eine große Ungerechtigkeit der „Natur“
beseitigen: Nördlich des Karre-Gebirges in der Zentralafrikanischen Republik,
das die Wasserscheide zwischen dem Tschadseebecken und dem Kongobecken bildet,
herrscht ständige Dürre, während südlich davon Wasser im Überfluß vorhanden ist
und ungenutzt in den Atlantik fließt. Wir sprechen vom Kongo, dem zweitlängsten
und wasserreichsten Fluß Afrikas, und von der Sahelzone, dem Trockengürtel, der
sich südlich der Sahara durch Nordafrika zieht.
© Bonifica S.p.A.
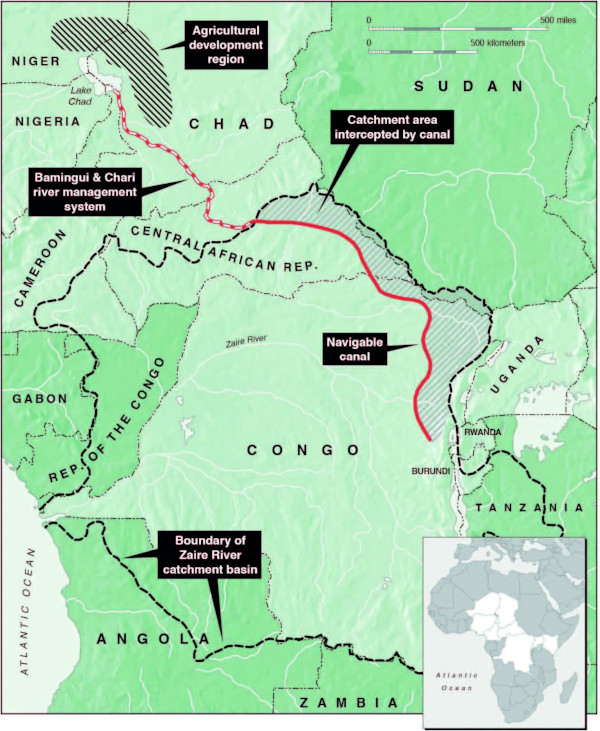
Schlüsselelemente des Transaqua-Projekts
Das Bonifica-Team unter der Leitung von Diplom-Ingenieur Marcello Vichi
berechnete, daß durch den Bau von Dämmen an den rechten Nebenflüssen des Kongo
und die Verbindung der daraus resultierenden Stauseen durch Kanäle eine 2400 km
lange Wasserstraße geschaffen werden könnte, die 5-8% des Kongo-Wassers nutzt
und es über den Chari, den einzigen Zufluß, in den Tschadsee leitet. Dies, ohne
einen Liter Wasser zu pumpen, es würde den gesamten Weg nur durch die
Schwerkraft fließen. Es wurde berechnet, daß auf diese Weise bis zu 100
Milliarden Kubikmeter Wasser jährlich umgeleitet werden könnten, wodurch man den
Tschadsee wieder auffüllen und Lebensbedingungen für bis zu 50 Millionen
Menschen wiederherstellen würde.
Darüber hinaus würde jeder der mehr als zwei Dutzend Dämme mit jeweils
mittelgroßen Kraftwerken (30 bis 100 MW Leistung) Wasserkraft erzeugen und so
den gesamten nordöstlichen Teil der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) und
die Zentralafrikanische Republik (ZAR) versorgen. Auf dem Weg hinab in Richtung
Tschadsee würde zusätzliche Wasserkraft erzeugt. Es wurde berechnet, daß eine
Kapazität von bis zu 7 GW aufgebaut werden könnte. Darüber hinaus würden die
Dämme die Wasserführung der Flüsse regulieren, die bisher immer wieder die
Ufergebiete überschwemmen, und so die Voraussetzungen für eine zuverlässige
agro-industrielle Entwicklung schaffen und das Wasserkraftpotential an
flußabwärts gelegenen Standorten wie dem Inga-Staudamm erhöhen. Nicht zuletzt
wäre die Wasserstraße schiffbar und würde so einen Transportweg bilden, der
sechs Länder direkt miteinander verbindet: DR Kongo, ZAR, Tschad, Kamerun, Niger
und Nigeria.
Transaqua würde den größten Nebenfluß des Kongo, des Ubangi, ganzjährig
schiffbar machen und könnte theoretisch auch eine Verbindung vom Tschadsee zum
Kongo und zum Meer herstellen. Das erfordert jedoch beträchtliche Arbeiten, denn
der Kongo ist derzeit aufgrund eines etwa 100 km langen Abschnitts mit
Stromschnellen nicht schiffbar. Dieses Problem muß durch ein Schleusensystem
gelöst werden.
2018 wurde dank einer Zusammenarbeit zwischen dem Schiller-Institut, den
Transaqua-Autoren und dem Unternehmen Bonifica (heute in Privatbesitz), der
Regierung Nigerias und der afrikanischen Kommission für das Tschadseebecken
(Lake Chad Basin Commission, LCBC) Unterstützung für Transaqua organisiert und
der Plan auf der Internationalen Tschadsee-Konferenz in Abuja im Februar 2018
angenommen. Alle LCBC-Mitgliedsländer – Nigeria, Tschad, ZAR, Niger, Kamerun und
Libyen – erklärten gemeinsam, daß Transaqua das einzige machbare Projekt zur
Rettung des Tschadsees ist, und verpflichteten sich, internationale finanzielle
Unterstützung für die Realisierung zu organisieren.
Die italienische Regierung, die zu dieser Zeit von Migrationswellen aus
Afrika, viele davon aus der Sahelzone, betroffen war, unterstützte die Erklärung
und verpflichtete sich, die Machbarkeitsstudie mitzufinanzieren. Im Oktober des
Jahres wurde dazu ein Protokoll von der LCBC und der italienischen Regierung
unterzeichnet. Leider führten ein Regierungswechsel in Rom und äußerer Druck auf
die LCBC-Länder dazu, daß nichts weiter geschah und der Schwung verlorenging. Es
bedarf jedoch nur des politischen Willens, um das Projekt wieder
aufzunehmen.
Die Kosten für den Bau von Transaqua sind zwar erheblich – mindestens 50
Milliarden Dollar –, aber das Projekt kann wie das Inga-Projekt in Phasen gebaut
werden. Die erste Phase würde die Zentralafrikanische Republik betreffen und am
letzten Damm vor der Wasserscheide am Kotto-Fluß beginnen und sich nach Süden
fortsetzen. Allein der Teil des Projekts für die rechten Nebenflüsse des Ubangi,
der vollständig auf dem Gebiet der ZAR liegt, würde es ermöglichen, etwa 20-30
Milliarden Liter Wasser pro Jahr in das Einzugsgebiet des Tschadsees umzuleiten,
den Ubangui zu regulieren und 2000 MW Wasserkraft zu erzeugen. Und auch wenn es
Jahre dauern wird, bis das erste Wasser zum Tschadsee fließt, gibt es von Anfang
an unmittelbare Vorteile in Form neuer Arbeitsplätze, sobald die ersten Bagger
die Erde bewegen.
cc

